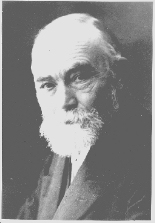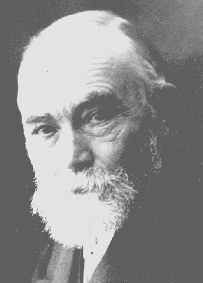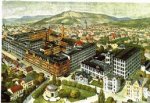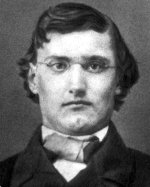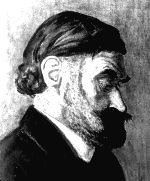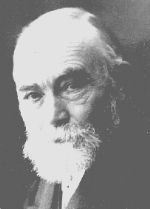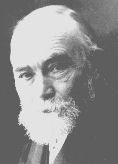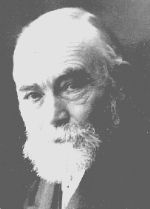|
Person, Werk und Wirkungsort Freges vorzustellen, Jena ist nicht nur im Bewußtsein der Jenenser ein Ort mit bedeutenden kulturellen Traditionen von Weltgeltung. Als Beleg dafür wird im allgemeinen auf literarische und philosophische Traditionen verwiesen, auf das Wirken Goethes und Schillers, auf Jena als Zentrum der Frühromantik und der Philosophie des klassischen deutschen Idealismus, dokumentiert durch die in Jena geschaffenen Werke solch bedeutender Persönlichkeiten der europäischen Geistesgeschichte wie Fichte, Schelling, Hegel, Hölderlin, die Gebrüder Humboldt, die Gebrüder Schlegel, Novalis, Tieck, Brentano, wobei diese Aufzählung längst nicht vollständig ist. Weniger Beachtung findet, daß Jena durch das nahezu fünfzigjährige
Wirken Gottlob Freges
an der Jenaer Universität, von
Beginn seines Studiums im Jahre 1869 an bis hin zur Emeritierung 1918,
untrennbar mit der Entstehung der modernen Logik verbunden ist, die auf
die Wissenschafts- und Technologieentwicklung des 20. Jahrhunderts einen
nachhaltigen Einfluß ausgeübt hat. Die überragende Bedeutung Freges für die Herausbildung der modernen Logik, der logischen Semantik und der analytischen Philosophie ist international unbestritten und hoch geachtet. Nicht nur für Alonzo Church ist Frege der größte Logiker der Neuzeit. Franz von Kutschera faßt seine Hochachtung vor der wissenschaftlichen Leistung Freges in die Worte:
Gottlob Frege gilt heute zu Recht als die zentrale Figur unter denen, die zur Begründung der modernen Logik beigetragen haben, und es ist auch nicht übertrieben, wenn man ihn oft als den bedeutendsten Logiker nach Aristoteles bezeichnet. Und unzweifelhaft ist Heinrich Scholz zuzustimmen, für den feststeht:
Das größte Genie der neueren Logik im 19. Jahrhundert ist aber unstreitig der deutsche Mathematiker Gottlob Frege.
Frege-Homepage der Stanford University
 
 Mit
Jena hatte sich Frege
1869 einen Studienort gewählt, der noch völlig dem
traditionellen Bild der deutschen Universitätsstadt entsprach,
in dem aktuelles Geschehen und Traditionen durch die
unauflösliche Verbindung von Stadt und Universität
bestimmt waren. Eingebettet in das herrliche Saaletal, umgeben von bis
zu 300 m aufragenden hellen Kalkfelsen, von Wäldern und
Feldern, ungestört von industriellen Einflüssen, mit
milden klimatischen Bedingungen, herrschten hier geradezu idyllische
Verhältnisse. Selbst die in anderen deutschen Städten
längst zum Alltag gehörende Eisenbahn machte bis 1876
noch einen Bogen um Jena. In Freges Jenenser Zeit fällt der
Aufstieg Jenas von dem durch die Menschen und ihre unmittelbaren
Beziehungen geprägten Universitätsstadt
zum industriellen Zentrum, in dem die Universität nicht mehr
dominierend ist, wo sich aber Industrie und Wissenschaft in einer
einzigartig fruchtbaren Weise verbinden und sich gegenseitig
ergänzen. bis Mitte des 19. Jahrhunderts  Erste Erwähnung fand die Siedlung Jani, aus der dann Jena hervorgegangen ist, um die Jahre 839/850 in einem Hersfelder Zinsregister. Diese Siedlung lag an einer Saalefurt an der Ostgrenze des Frankenreiches, nahe an slawischem Siedlungsgebiet, auf das noch heute Namen von Ortschaften wie Nerkewitz, Kospeda, Zwätzen hinweisen. Seit dem 12. Jahrhundert unterstand das Dorf Jene den Herren von Lobdeburg und entwickelte sich zu einem Handwerks- und Handelsplatz. Bekannt wurde Jena auch als Münzstätte. Das wichtigste Gewerbe war aber weiter die Landwirtschaft, vor allem der an den Saalehängen betriebene Weinbau. Das Stadtrecht wurde Jena um 1230 verliehen. Im 13. Jahrhundert wurden bereits Stadtbefestigungen angelegt, die mit der Erweiterung der Stadt weiter ausgebaut wurden. Von besonderer Bedeutung bis ins 20. Jahrhundert hinein ist der im Jahre 1331 erfolgte Übergang Jenas in den Besitz des Wettiner Adelsgeschlechts. Im 14./15. Jahrhundert entwickelte sich Jena zu einem wirtschaftlichen Zentrum des thüringischen Gebietes. Weinbau und entwickelte Handelsbeziehungen waren die wichtigsten Grundlagen des wirtschaftlichen Gedeihens Jenas, auf deren Basis immer mehr Feudalrechte an die Stadt und ihren Rat übergingen. Um 1485/86 spaltete sich das Wettiner Haus in den Leipziger und den Altenburger Zweig. Jena wurde dem Kurfürst Ernst zugeschlagen und verblieb bis nach Ende des 1. Weltkrieges im Hoheitsbereich der ernestinischen Linie. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts hatte Jena für damalige Verhältnisse ansehnliche 3800 Einwohner. Im Verlaufe der Reformation kam 1524 Luther nach Jena, um sich mit dem radikaleren Prediger Andreas Karlstadt und dessen Anhängern auseinanderzusetzen. Am 22. August 1524 trafen sich Luther, Karlstadt und dessen Jenenser Anhänger Martin Reinhard und G. Westerburg zu einem Streitgespräch in der Gaststätte Zum schwarzen Bären. Während des Bauernkrieges wurden durch Anhänger Thomas Müntzers in Jena die Klöster der Dominikaner und Karmeliter gestürmt. Die Stadt beteiligte sich dann mit 100 Bewaffneten an der Niederwerfung des Müntzerschen Heeres am 15. Mai 1525. Im Ergebnis der Reformation wurden die Klöster in Jena säkularisiert und eine Stadtschule eingerichtet. Von weit größerer Bedeutung für Jena und den gesamten Thüringer Raum war aber der Entschluß von Kurfürst Johann Friedrich I., dem Großmütigen, im Jahre 1548 eine Hohe Schule, das Akademische Gymnasium in Jena zu gründen, die ihren Platz im ehemaligen Dominikanerkloster fand. Johann Friedrich I. wollte damit Ersatz für die Universität Wittenberg schaffen, die er im Schmalkaldischen Krieg von 1546/47 zusammen mit dem sächsischen Kurkreis und der Kurwürde verloren hatte. Die sofortige Gründung einer neuen Universität scheiterte am Widerstand von Karl V.
Die
Eröffnung der Hohen Schule fand am 19. Mai 1548 statt und mit
zwei Wittenberger Melanchton-Schülern, Johannes Stigel (Poet
und erster Rektor) und Victorin Strigel (Theologe und Philosoph),
wurden die ersten Professoren der Hohen Schule berufen, in deren
Matrikel sich bis Ende 1548 bereits 171 Studenten eingetragen hatten.
Durch die ernestinischen Teilungen von 1572 und 1640 gehörte Jena zum Herrschaftsgebiet der Herzöge von Sachsen-Weimar. Die Erhaltung der Universität blieb aber weiter Aufgabe der aus den Teilungen hervorgegangen Staaten Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg-Saalfeld. Die Universität nahm als thüringische Territorialuniversität eine gute Entwicklung und verfügte bereits 1596 über 760 eingeschriebene Studenten. Einen großen Rückschlag brachte der Dreißigjährige Krieg, in dem Jena 1637 durch kaiserliche Truppen verwüstet wurde und bis Ende des Krieges über ein Jahrzehnt lang unter wechselnden Besatzungen zu leiden hatte. Im Gefolge dessen erreichten auch die Studentenzahlen 1641/42 mit 250 Studenten einen Tiefpunkt, von dem sich die Universität bis 1690 aber soweit erholte, daß in diesem Jahr 1200 Studenten eingeschrieben hatten. Mitten im Dreißigjährigen Krieg, 1633, verbesserte sich die wirtschaftliche Selbständigkeit der Universität entscheidend: Bis zu diesem Jahr war die Universität vollständig auf unmittelbare Staatszuschüsse von den Erhalterstaaten angewiesen. Nach Überschreibung der Güter Remda und Apolda war die Universität in der Lage, ihre Finanzen genauer zu planen, und sie konnte drei Viertel der Besoldungen selbst decken, wodurch sich natürlich auch die Freiheit der Universität in den eigentlichen Universitätsbelangen erhöhte. Diese Bedingungen wurden von der Universität hervorragend benutzt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts rückte die Universität an die Spitze der deutschen Universitäten und erlangte gesamteuropäische Bedeutung. Als herausragender Erneuerer der Wissenschaft dieser Zeit gilt Erhard Weigel (1625-1699), der 1653 an die Jenenser Universität berufen wurde und hier vor allem in der Philosophie und Mathematik wirkte. Mit seiner Betonung der Mathematik als Grundlage aller Wissenschaften, auch der Philosophie, nahm er eine Hauptforderung des französischen Philosophen Rene Descartes auf. Durch die Betonung mathematischer Berechnungen, des Experimentierens und der Naturbeobachtung als Grundlagen dogmenfreier Wissenschaft setzte er sich in Gegensatz zur herrschenden scholastischen Wissenschaftsauffassung und wurde zum bedeutendsten Vertreter der Jenaer Frühaufklärung. Sein Ruf verbreitete sich bereits während seines langjährigen, von 1653 bis 1699 dauernden Wirkens an der Universität weit über die Grenzen Jenas und Thüringens hinaus und zog eine Vielzahl bedeutender Schüler an, die später selbst im Sinne Weigels die antidogmatische und antischolastische Erneuerung der Wissenschaften vorantrieben. Sein berühmtester Schüler ist ohne Zweifel Gottfried Wilhelm Leibniz, auf dessen Idee der lingua charcteristica universalis, einer umfassenden formalisierten Kalkülsprache als Teil der scientia generalis, der Universalsprache der Wissenschaft, sich später auch Gottlob Frege als Ideengeber für sein Werk der Neubegründung der Logik berufen konnte. Die Universität Jena wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum wichtigsten Platz der deutschen Frühaufklärung unter den protestantischen deutschen Universitäten. Die überregionale Bedeutung Jenas in dieser Zeit erhellt auch daraus, daß zwischen 1652 und 1723 Thüringer nur einen geringen Anteil der Studenten ihrer Landesuniversität stellten. Nahezu drei Viertel waren Ausländer, zu denen freilich auch die nichtthüringischen Deutschen gezählt wurden. Eine besondere Anziehungskraft übte der hohe Stand der in Jena vertretenen Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin aus. Durch ihren Aufschwung wurde die Universität zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor in Jena. Handel und Handwerk profitierten in bedeutendem Maße von der Universität. Jena wurde neben Leipzig ein Zentrum des deutschen Verlagswesens und der Buchdruckerei. Auch die Bautätigkeit wurde stark belebt. In die Periode des Barock fällt auch die kurze geschichtliche Episode, in der Jena zur Residenzstadt des von 1672 bis 1690 existierenden, nur 515 km2 großen Herzogtums Sachsen-Jena erhoben wurde. Auch
im ersten Drittel des 18. Jahrhundert war die Jenenser
Universität stark von Studenten frequentiert. Mit
über 700 jährlichen Einschreibungen und einer
Gesamtzahl von 1800 Studenten - eine Studentenzahl, die Jena erst im
20. Jahrhundert wieder erreichte - verfügte Jena im zweiten
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts über die am stärksten
besuchte deutsche Universität. Danach blieb Jena allerdings
gegenüber anderen deutschen Universitäten
zurück. Das drückte sich auch in sinkenden
Studentenzahlen aus. Von 1761 bis 1777 studierten durchschnittlich nur
noch 700 Studenten in Jena, was die wirtschaftliche Lage Jenas
erheblich belastete. Einen
neuen Aufschwung erlebte Jena und seine Universität mit der
Regierungszeit von Herzog Carl August und dem Wirken Goethes in Weimar
und Jena. Die Universität erlebte so zwischen 1785 und 1819
eine neue Blütezeit. Für kurze Zeit wurde Jena sogar
nach Halle zur zweitgrößten deutschen
Universität. Trotzdem teilte Jena mit anderen deutschen
Universitäten um die Jahrhundertwende das Schicksal sinkender
Studentenzahlen. Viele deutsche Universitäten schlossen in
dieser Zeit ihre Pforten:FN1
Diesen zweiundzwanzig Universitätsschließungen standen nur vier Ersatzgründungen gegenüber: 1802 Landshut, 1808 Aschaffenburg (1811 wieder geschlossen), 1809 Berlin und 1818 Bonn. Auch in Jena hing die Gefahr der Schließung der Universität wie ein Damoklesschwert über der Stadt. Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts verstummten die Diskussionen und Gerüchte darüber nicht. Zumindest um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde allerdings die Existenz der Universität Jena durch den auf Wissenschafts- und Kunstförderung bedachten Weimarer Hof nicht zur Disposition gestellt: "An eine Schließung der Jenaer Universität ist ernsthaft nie gedacht worden, so schwer auch die finanziellen Lasten auf die Regierung gedrückt haben mögen. Ja, selbst Besuchsverbote, die Kursachsen, Preußen u.a. gegen Jena verhängten, haben schließlich doch nur dazu geführt, den guten Ruf unserer Universität als Hort der Freiheit nicht nur wachzuhalten, sondern zu stärken."FN2 Nachdem
sich Jena schon als Zentrum der Frühaufklärung und
des Frühkantianismus einen Namen gemacht hatte, wird die
Universität in die beiden Jahrzehnte um die Jahrhundertwende
zum Zentrum der Philosophie des klassischen deutschen Idealismus, der
seine Weltgeltung bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Philosophen
wie Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg
Wilhelm Friedrich Hegel gaben dieser Philosophie in Jena ihr
Gepräge. Von
längerer unmittelbarer Wirksamkeit in Jena war die Berufung
des vor allem naturphilosophisch bedeutenden Kantianers Jakob Friedrich
Fries (1773-1843), der Jena zwar 1806 verlassen hatte, über
Heidelberg aber 1816 wieder nach Jena zurückkehrte und hier
bis an sein Lebensende wirkte. FN1
Vgl.: Koch, Herbert: Geschichte
der Stadt Jena. Stuttgart 1966,
S. 242. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Kuratoren der Universität Im August 1819 wurden alle deutschen Staaten durch die Karlsbader Beschlüsse verpflichtet, für ihre Universitäten die Stelle eines Kurators zu schaffen, der als Regierungsbevollmächtigter alle wichtigen Angelegenheiten der Universität zu überwachen hatte.FN1 Dem Kurator oblag es, zu Habilitationsgesuchen und Berufungsvorschlägen vor ihrer Weiterleitung an die Regierung seine Stellungnahme abzugeben, nachdem diese im Beisein des Kurators bereits von Fakultät und Senat der Universität gebilligt worden waren. Dabei stellte seine Stellungnahme die entscheidende Grundlage für die Beschlußfassung durch die Regierung dar. In den Karlsbader Beschlüssen war diesem Amt vorrangig eine Überwachungsfunktion gegen jakobinische und liberale Tendenzen an den Universitäten zugedacht gewesen. Die damit verbundene Einschränkung der Universitätsautonomie ordnete sich so in die mit den Karlsbader Beschlüssen verbundenen Einschränkungen allgemeiner bürgerlicher Rechte ein. In Sachsen-Weimar, mit dem liberalen Herzog Carl August an der Spitze, der zugleich formell als Rector magnificentissimus die Universitätshierarchie anführte, hatte die Errichtung des Kuratels entgegen aller Erwartung durchaus positive Folgen. Von Beginn an sahen die vom jeweiligen Herzog bestellten Kuratoren ihre Aufgabe darin, möglichst günstige Bedingungen für die Arbeit der Universität zu schaffen. Zu diesen Bedingungen zählten sie auch geistige Freiheit. So konnte Jena nach der Berufung Ernst Haeckels zu einem Zentrum des in dieser Zeit geradezu verfemten Darwinismus werden und verhalf dieser Theorie nicht nur in Deutschland zum wissenschaftlichen Durchbruch. Die Kuratoren waren bestrebt, in den Beziehungen zwischen Universität und den Regierungen der Erhalterstaaten zu vermitteln und waren dabei in einer vorteilhaften Lage: Einmal hatten sie als Beauftragte der Regierungen deren Vertrauen und standen nicht im Verdacht, einseitig und im eigenen Interesse Universitätsbelange zu vertreten. Andererseits waren sie durch ihren ständigen unmittelbaren Kontakt mit den Universitätsangelegenheiten vertraut, die sie nicht vorrangig aus dem Schriftverkehr kannten, sondern mit denen sie im persönlichen Kontakt mit den Professoren in Fakultäts- und Senatssitzungen, aber auch im persönlichen Gespräch konfrontiert wurden. Entscheidungsverfahren konnten so durch die verbindliche Meinungsbildung des Kurators abgekürzt werden, wobei im allgemeinen von beiden Seiten akzeptierte Kompromisse zwischen den Wünschen der Universität und den Möglichkeiten der Erhalterstaaten gefunden wurden. In dieser Weise wirkten bereits die ersten Kuratoren Motz und Ziegesar. Als 1849 die Möglichkeit bestand, dieses durch die Karlsbader Beschlüsse aufgedrängte Amt wieder abzuschaffen, hatte es sich durch die Arbeit dieser beiden Kuratoren so sehr bewährt, daß auch die Universität keine Veranlassung hatte, sich von der Beseitigung dieser Institution Vorteile zu versprechen. Das Vertrauen in diese Institution wurde dann auch durch die folgenden Kuratoren voll gerechtfertigt. In besonderer Weise hat der von 1851 bis 1877 amtierende Kurator Moritz Seebeck die Universität gefördert. Er verstand sich nicht als Verwalter, sondern als Teilnehmer an Entscheidungsprozessen, wozu auch gehörte, sich ein fundiertes eigenständiges Urteil zu bilden. "Der hochgebildete Seebeck verließ sich in den Berufungsverhandlungen nie allein auf die Gutachten der Fachgelehrten, sondern bildete sich durch Literaturstudien und Vorlesungsbesuche ein ausgewogenes Urteil über die Lehrstuhlkandidaten. Die zuständigen Minister in Weimar, Gotha, Altenburg und Meiningen vertrauten ihm fast blindlings und stimmten den außergewöhnlichsten Vorschlägen zu."FN2
Seebeck war es zu danken, daß Kuno Fischer nach Jena berufen wurde, nachdem im Jahre 1855 die einzigen Lehrstühle für Philosophie durch den Tod von Ernst Reinhold und Karl Friedrich Bachmann verweist waren. Einer der beiden Lehrstühle wurde mit dem schon seit 1839 in Jena lehrenden Ernst Friedrich Apelt besetzt, der als Schüler von Fries eine bedeutende Jenenser philosophische Tradition weiterführte. Seine Lehrveranstaltungen waren nicht auf die Philosophie beschränkt, sondern erstreckten sich auch auf Mathematik und Naturwissenschaften. Für Kuno Fischer kam das Angebot, sich auf einen der beiden Lehrstühle berufen zu lassen, in einer schwierigen Phase seiner wissenschaftlichen Laufbahn. In der sich nach der 1848/49er Revolution in vielen deutschen Staaten ausbreitenden antiliberalen Grundstimmung war ihm nämlich 1853 in Heidelberg mit dem Vorwurf, pantheistische Lehren zu vertreten, die Lehrberechtigung abgesprochen worden. Seine Berufung nach Jena ist ein Indiz dafür, daß die thüringischen Erhalterstaaten der Universität Jena, vor allem aber Sachsen-Weimar mit dem dort von 1853 bis 1901 regierenden Großherzog Carl Alexander (1818-1901), sich diesem Trend nicht vorbehaltlos unterordneten, sondern durchaus darauf bedacht waren, Universitätsbelange unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung wissenschaftlicher Potenzen zu behandeln und nicht primär auf Basis politischer Rücksichten. Auf dieser Basis profitierte die Jenenser Universität durch die kluge Berufungspolitik ihres Kurators Seebeck - hier konkret im Falle Fischers - sogar von der antiliberalen Hochschulpolitik anderer deutscher Staaten. Fischer selbst beschreibt die Situation so: "Was damals einer Universität an Lehrkräften durch politische und kirchliche Verfolgungen verloren ging, konnte eine andere, die von solchen Angriffen verschont blieb, gewinnen und für Deutschland erhalten. In einer so günstigen, fast einzigen Lage im Anfange der fünfziger Jahre befand sich Jena, und Seebeck, der wohl conservativ im besten Sinne des Wortes, aber gar nicht reactionär gesinnt war, wußte diese Conjunctoren der Zeit für die Universität wohl zu benutzen."FN3 Fischer wurde in Jena zu einem Glanzpunkt der philosophischen Fakultät und des gesamten Universitätslebens. Seine Vorlesungen waren - ganz im Gegensatz zu denen des frühen Abbe und Freges - gesellschaftliche Ereignisse von Rang für die Universität und die Stadt Jena. Es gab wohl kaum Studenten, die nicht seine Vorlesungen besucht hätten. Von allen Zeitzeugen wird die hervorragende Vortragskunst Fischers gerühmt. Das große Interesse der Öffentlichkeit wurde auch nicht dadurch getrübt, daß Kuno Fischer als ausgesprochen arrogant und dünkelhaft galt. So berichtet Koch über Fischer: Eines Tages traf ihn ein Kollege auf dem Fürstengraben, hörte ihn in Selbstgespräche versunken und fragte ihn, ob er dies zu tun gewohnt sei. 'Ja, wissen Sie, es ist mir immer wertvoll, die Worte eines bedeutenden Geistes hören zu können.' Als er aber Jena verlassen hatte, bemerkte er: 'Mein Haus übernahm ein Seifensieder und meinen Lehrstuhl ein Leimsieder', womit er Rudolf Eucken meinte."FN4 Der Kurator Seebeck strebte für die Universität ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Geistes- und Naturwissenschaftlern an und sah es als seine wichtigste bildungspolitische Aufgabe, die Universität durch Gewinnung junger aufstrebender Wissenschaftler zu fördern. Die Universität sollte den Rahmen für die Entfaltung unverbrauchter schöpferischer Kräfte liefern, wozu geistige Freiheit und das Beschreiten neuer Wege in der wissenschaftlichen Arbeit gehörten. Er scheute sich nicht, die Berufung eines Zwanzigjährigen, E. Sievers, zum Professor der Germanistik zu empfehlen. Auch die vorbehaltlose Förderung Ernst Haeckels machte er zu seiner Angelegenheit. Und ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen, den jungen Ernst Abbe der Wissenschaft und der Universität zu erhalten, der aufgrund seiner unerträglichen materiellen Situation ernsthaft entschlossen war, die Universität zu verlassen und sich um eine Gymnasiallehrerstelle zu bewerben. Es muß nicht weiter begründet werden, welches historische Verdienst sich Seebeck allein dadurch für die Universität, die Stadt Jena und den Thüringer Raum erworben hat. Und schließlich hätte Gottlob Frege ohne Ernst Abbe wohl kaum sein Werk der Begründung der modernen Logik in Jena vollenden können. Seebeck bewies bei seinen Aktivitäten ein unglaublich sicheres Einschätzungsvermögen für das Machbare und im Sinne der Universität Anzustrebende. Es fehlte ihm dann auch nicht an Durchsetzungskraft, seine Entscheidung mitunter gegen beharrliche Forderungen aus den Reihen der Universität zu behaupten. So verhinderte er die Berufung von Eugen Dühring als Nachfolger für Kuno Fischer, obwohl er nach eingehendem Studium der wissenschaftlichen Arbeiten Dührings deren Substanz respektierte. Seine Entscheidung gegen Dühring war auf dessen offen sozialdemokratische und antireligiöse Grundhaltung bezogen, durch die er eine unannehmbare politische Belastung auf die Universität zukommen sah. Das Besetzungsverfahren für diesen Lehrstuhl endete schließlich mit der Berufung Rudolf Euckens, des ersten und einzigen Nobelpreisträgers der Universität Jena. Auf Seebeck folgten die Kuratoren August v. Türcke (von 1878 bis 1884, also die Zeit, in der Gottlob Frege seine Begriffschrift und die Grundlagen der Arithmetik schrieb), Heinrich von Eggeling (1884-1909) und Max Vollert (1909-1922).
Heinrich von Eggeling Nicht nur wegen der langen Amtszeit verdient Eggeling besondere Erwähnung.
Eggeling war ein Studienfreund Abbes und hatte ebenfalls Mathematik
studiert. Er trat auch als Mitglied der Schäfferschen Mathematischen
Gesellschaft und deren Preisträger in Erscheinung. In seine
Amtszeit fällt die Errichtung des Materialfonds für
wissenschaftliche Zwecke 1886 und der Carl-Zeiss-Stiftung 1889
durch Abbe. Zwischen Abbe und Eggeling bestand ein sehr enges und
vertrauensvolles Verhältnis, ohne das es Abbe wohl kaum möglich
gewesen wäre, sein Stiftungswerk zu schaffen. Andererseits war
Eggeling eher zögerlich, wenn es um Berufungsfragen ging, worunter
auch Frege zu leiden hatte, auch wenn der Einfluß Abbes auf Eggeling
und das Ministerium in Weimar schließlich doch groß genug war,
um die Berufung Freges zum Honorarprofessor durchzusetzen. FN1 Vgl.: Vollert, Max: Geschichte
der Kuratel der Universität Jena. Jena 1921. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hatte die 1848er Revolution in Deutschland kaum tiefgreifende politische Veränderungen hervorgerufen, so blieb Jena auch noch Jahre nach der Reichsgründung von 1871 von wirtschaftlich-industriellen Entwicklungen weitgehend verschont. Jena gehörte zum Großherzogtum Sachsen-Weimar, in dem die große kulturelle Tradition fortwirkte, der sich nach seinem erfolgreichen Großvater Carl August nun auch der herrschende Großherzog Carl Friedrich verpflichtet fühlte. Den kulturellen adäquate wirtschaftliche Erfolge blieben allerdings weiterhin aus. Dies war nicht einer unklugen Politik des Regenten geschuldet. Dieser trug den Bestrebungen zur Überwindung der durch die Kleinstaaterei hervorgerufenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten durchaus Rechnung. Die Kleinstaaterei als Ursache der Misere war auch durch die beste Politik nicht vergessen zu machen: "Die Kleinheit des Landes mit seinen 3580 qkm, das noch dazu in drei voneinander getrennte Teile (Weimar-Jena, Eisenach und Neustadt a/O.) zerrissen war, die ihrerseits ringsum vom <Ausland> umschlossen und von dessen Wirtschaft mitbedingt waren, ließen natürlich eine großzügige Politik nicht zu."FN1 Nicht nur Sachsen-Weimar war in dieser Weise zersplittert. Thüringen insgesamt war auch nach der Reichsgründung von 1871 das am meisten zergliederte Territorium Deutschlands. Die vier Erhalterstaaten der Universität, das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und die Herzogtümer Sachsen-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Altenburg verloren erst 1918 ihre staatliche Selbständigkeit. Sachsen-Weimar hatte ganze vier im damaligen Verständnis größere Städte: die Residenzstadt Weimar, Apolda mit relativ ausgeprägten industriellen Ansätzen, Eisenach mit einigen Industriebetrieben und Jena mit seiner vollständigen Fixierung auf die Universität. Die größte Stadt im Lande war Weimar mit 12000 Einwohnern; Jena kam auf etwa die Hälfte: Ende 1858 ergab eine Zählung 6874 Einwohner. Diese Zahl war über ein halbes Jahrhundert nahezu unverändert geblieben und zehn Jahre lang soll in Jena kein Haus gebaut worden sein.FN2 So nimmt es auch nicht Wunder, daß Jena um 1860 von der Anlage her noch gut als mittelalterliche Stadt zu erkennen war. Die jahrhundertealten Befestigungen waren noch gut rekonstruierbar: Die als Ruinen erhaltenen Ecktürme des rechteckigen Befestigungssystems waren durch Straßen verbunden, die den ursprünglichen Stadtmauern folgten. Hausnummern waren unbekannt, statt dessen wurden die Wohnungen durch den Namen des Hauswirtes gekennzeichnet. So überflüssig wie die Hausnummern waren öffentliche Verkehrsmittel. Selbst die von Goethe probeweise erstmals in Deutschland eingeführte Gasbeleuchtung war nicht mehr vorhanden. Straßenlaternen schienen so ungewöhnlich gewesen zu sein, daß die am Anfang der Neugasse befindliche Laterne als achtes Weltwunder bezeichnet wurde, weil sie vier Straßen beleuchtete. (Auerbach, 49f.) Mit der wirtschaftlichen Abgeschiedenheit Jenas ging die verkehrstechnische Abgeschiedenheit einher: Jena war als letzte deutsche Universitätsstadt noch bis 1874 ohne Eisenbahnanschluß. Selbst Weimar, Apolda und Eisenach waren durch die Thüringische Eisenbahn weit vor Jena mit dem Eisenbahnnetz Deutschlands verbunden. Wer reisen wollte, mußte zu Fuß oder (nicht schneller, aber weniger anstrengend) mit dem Pferdeomnibus die ca. 15 km bis zu den Bahnhöfen in Apolda oder 25 km bis nach Weimar überwinden. Jena blieb so auch von dem mit der Eisenbahnanbindung verbundenen allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung verschont, ein Resultat, in dem eine Jenenser Fraktion geradezu einen Segen erblickte. Bei 1857 geführten Verhandlungen zur Anbindung Jenas an die Eisenbahn formierten sich die Gegner dieser Anbindung unter Losungen wie der, die Bahn würde das Ende der Jenaischen Einfachheit bedeuten. Mit der Eisenbahn sahen sie auch das Ende der Universität kommen, denn dann würde alles teurer werden, die Professoren würden höhere Gehälter fordern, die das Land dann nicht mehr bezahlen könne oder wolle. (Auerbach, 50) Aber auch unabhängig von den Diskussionen um die Eisenbahnanbindung schien Mitte des 19. Jahrhunderts die Existenz der Universität ein viel zu großer Luxus für ein so kleines Land wie Sachsen-Weimar zu sein. In der Diskussion war die Schließung der naturwissenschaftlichen Fächer und auch die völlige Schließung der Universität. Dabei entsprach der Zuschuß von 75000 Mark für die Universität gerade soviel, wie für 125 Soldaten auszugeben war. Die Professorengehälter waren diesem Niveau angepaßt: Ein Ordentlicher Professor konnte mit 200 Talern im Jahr rechnen, in Ausnahmefällen mit 300 Talern. (Auerbach, 50) Finanzielle Sorgen waren auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Hauptproblem der thüringischen Erhalterstaaten der Universität. Eine gewisse finanzielle Entspannung, die auch der Jenenser Universität zugute kam, erlebte Sachsen-Weimar durch die Heirat des Großherzogs Carl Friedrich, dessen Gemahlin Sophie aus den Niederlanden ein beträchtliches Vermögen mit nach Weimar brachte. Aber diese Aufstockung der Staatsfinanzen konnte die schwierige finanzielle Situation des Staates und damit auch der Universität nicht grundsätzlich verändern. Noch nach 1870 verstummten deshalb Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Schließung der Universität nicht. In dieser Situation wurde der Universität von dem Altenburger Kaufmann Wilhelm Reichenbach die gewaltige Summe von 550 000 Reichsmark vererbt, was zum endgültigen Verstummen der Schließungsgerüchte führte. Aber auch diese Stiftung war ein einmaliger Akt. Dauerhafte nichtstaatliche Hilfe, auf die sich die Universität in ihren weitergehenden Planungen stützen konnte, wurde ihr erst durch die 1889 von Ernst Abbe gegründete Carl-Zeiss-Stiftung zuteil. Ernst Abbe, der spätere Lehrer und Förderer Gottlob Freges, hatte die durch die Finanznot der Universität hervorgerufene bauliche, instrumentelle und personelle Beengtheit der Universität noch als Student und später lange Jahre in seiner Lehr- und Forschungstätigkeit gespürt. Bis Ende der 50er Jahre gab es lediglich im historischen Gründungsgebäude, dem Collegienhof, einige öffentlich nutzbare Räume; grundsätzlich mußte jeder Lehrende selbst für entsprechende Räumlichkeiten für seine Vorlesungen sorgen. Diese Lage verbesserte sich erst ab 1861, nachdem die ehemalige Studentenkaserne Wucherey zu einem für Jenaer Verhältnisse großem Hörsaal- und Verwaltungsgebäude umgebaut worden war. Auch die Versorgung mit naturwissenschaftlichen Apparaturen, Sammlungen etc. war nahezu nicht vorhanden: Zufällig angesammelte Instrumente (vor allem aus der Zeit Goethes) wurden durch persönliches Eigentum der Professoren ergänzt. Bei anstehenden Berufungen konnte es sich die Universität nur in Ausnahmefällen erlauben, renommierte Wissenschaftler von außerhalb zu gewinnen. Priorität bei Entscheidungen hatten letztlich die finanziellen Verhältnisse. Paradoxerweise hatte diese unbefriedigende Lage aber auch positive Folgen: Die Universität war dadurch gehalten auch jungen aufstrebenden Kräften zu vertrauen, die zielstrebig an der Universität gefördert wurden (Beispiele dafür sind Ernst Abbe und Gottlob Frege) oder bei Bewerbungen von außerhalb auch gegen renommierte Wissenschaftler gute Chancen hatten. Andererseits wurde es der Universität schwer, Wissenschaftler, die zu Beginn ihrer akademischen Karriere nach Jena gekommen waren und sich in dem fruchtbaren geistigen Klima der Universität gut entwickelt hatten und beachtliche wissenschaftliche Leistungen vollbrachten, in Jena zu halten. Jena kam so in den Ruf einer Aufstiegs- und Durchgangsuniversität. Als Ernst Abbe 1857 nach Jena kam, gab es an der philosophischen Fakultät acht Stellen: fünf geisteswissenschaftliche und drei naturwissenschaftlich-mathematische. Das hieß, es gab eine Professur für Chemie, eine für Naturgeschichte (Mineralogie, Geologie, Botanik, Zoologie) und eine für exakte Wissenschaften (Mathematik, Physik, Astronomie). Zur Unterstützung der Ordinarien lehrte eine geringe Anzahl außerordentlicher Professoren und Privatdozenten. Die exakten Wissenschaften, denen sich Abbe und 10 Jahre später auch Gottlob Frege widmeten, hatten lediglich einen Ordinarius, Professor Karl Snell. Zusammen mit dem Privatdozenten und späteren außerordentlichen Professor Hermann Schaeffer hatte er die gesamte Physik und Mathematik zu bewältigen. Für Astronomie war der außerordentliche Professor Ludwig Schrön zuständig. Noch vor Freges Studienbeginn in Jena hatte sich die Lage bedeutend dadurch gebessert, daß Ernst Abbe in den Lehrkörper eingetreten war und damit endlich auch höhere Gebiete der Mathematik dem modernen Forschungsstand entsprechend den Studenten geboten werden konnten.
Auch die Studentenzahlen waren weit geringer als zu den besten Tagen der Universität und keineswegs im Wachsen begriffen. Im Sommer 1857 waren 382 Studenten eingeschrieben, 182 aus den Erhalterstaaten ("Inländer") und 202 Ausländer, meist aus Preußen, aber auch aus Ländern außerhalb Deutschlands. Diese Studenten verteilten sich auf die vier Fakultäten Theologie (103) , Jurisprudenz (78), Medizin (52) und Philosophie (149, davon ca. 90 Geisteswissenschaftler und 60 Naturwissenschaftler). Obwohl Jena Universitätsstadt war, gab es Mitte des 19. Jahrhunderts in Jena keine höhere Schule. Erst 1876 hatte sich der Staat entschließen können, das Carolo-Alexandrinum-Gymnasium zu gründen. Der Mitte des 19. Jahrhunderts stagnierenden Entwicklung der Universität und des geistigen Lebens in Jena entsprach ein ebenso bescheidenes wirtschaftliches Leben in der Stadt Jena, das ganz auf die Belange der Universität ausgerichtet und auf das Notwendigste beschränkt war. Eine bei Auerbach (Auerbach, 49) zu findende Anekdote soll das illustrieren: Es wird berichtet, ein neu in Jena angekommener Student habe sich durch seine Haushälterin etwas Schinken holen lassen wollen, der Fleischer die Frau aber damit beschieden, sie solle anfragen, ob der Herr Student nicht wisse, daß Ferien seien, und da werde kein neuer Schinken angeschnitten.
Jena auf dem Weg zur Industriestadt
Von Ansätzen der sich in Europa entwickelnden industriellen Revolution war Mitte des 19. Jahrhunderts in Jena kaum etwas zu spüren. Lediglich einige Kleinbetriebe, die aber die Größe von Handwerksbetrieben kaum überschritten, darunter 1820 die erste Kammgarnspinnerei, deuteten an, was sich in der Welt vollzog. Die erste Dampfmaschine Jenas wurde erst 1864 in der erwähnten Kammgarnspinnerei aufgestellt. Der Keim für den wirtschaftlichen Aufschwung Jenas wurde aber noch vor Mitte des 19. Jahrhunderts gelegt, als Carl Zeiß (1816-1888) im Jahre 1846 seine mechanische Werkstatt in Jena eröffnete. Carl Zeiß 
Carl Zeiß um 1870
Koch beschreibt den Lebensweg von Carl Zeiß bis zur Gründung der Jenaer Werkstätte folgendermaßen: "Carl Friedrich Zeiß wurde am 11. September 1816 in Weimar geboren. Sein Vater war Hof- und Kunstdrechslermeister ... Der Knabe besuchte das Gymnasium, zugleich aber auch die Gewerbeschule und trat 1834 als Lehrling bei dem Jenaer Universitäts- und Hofmechanikus Dr. Fridrich Körner in die Lehre, hörte aber zugleich auch physikalische und mathematische Kollegs an der Universität. Dann ging er auf Wanderschaft, über Stuttgart und Darmstadt hörte er 1842/43 am Polytechnikum in Wien Kollegs über Mechanik und arbeitete in der Maschinenfabrik von Rollé & Schwilque, vollendete seine Studien beim Mechaniker C. Lüttich in Berlin und ließ sich am 27. Oktober 1845 wieder in Jena immatrikulieren, um seine Kenntnis in Chemie und mathematischer Analyse zu vervollkommnen und am physiologischen Institute zu arbeiten. Sein Gesuch, sich in seiner Geburtsstadt als Mechanikus niederlassen zu können, wurde abgelehnt, weil es in Weimar bereits zwei Mechaniker gab, und so wandte er sich am 10. Mai 1846 an den Stadtrat in Jena." (Koch, 266f.) Hier fand er einen Fürsprecher in Professor Schleiden, und seinem Gesuch wurde schließlich stattgegeben. Bereits am 17. November 1846 konnte er seine Werkstatt in der Neugasse 7 eröffnen. Der Geschäftsverlauf war so günstig, daß er bereits am 1. Juli 1847 in ein größeres Haus in der Wagnergasse 3 umziehen mußte. Dort stellte er im gleichen Jahr seinen ersten Lehrling und späteren Werkmeister August Löbel ein.
Erste Zeiß-Werkstätte 1846 Durch den Botaniker Schleiden wurde Zeiß angeregt, sich auch dem Bau von Mikroskopen zuzuwenden. Nachdem er sich ursprünglich erfolgreich mit der Fertigung von sogenannten Doublets, Mikroskopen mit zwei plankonvexen, fest miteinander verbundenen Linsen, etabliert hatte, von denen er in seiner kleinen Werkstatt immerhin 2000 Stück fertigte, begann er Mitte der Fünfziger Jahre mit der Produktion von zusammengesetzten Mikroskopen, die für die stark vergrößerte Betrachtung kleiner, nahe gelegener Gegenstände geeignet waren. Dazu wurden, wie man es nach heutigen Vorstellungen von einem Mikroskop erwartet, Objektive und Okulare in ein Rohr eingepaßt und mit verschiedenen Hilfsteilen verbunden. Von diesen technisch aufwendigeren Mikroskopen im engeren Sinne konnte Carl Zeiß von 1858 bis 1863 gerade 106 Stück absetzen. Da war die Steigerung 1864 auf 63 Stück, 1865 auf 66 Stück und 1866 auf 146 Stück schon beachtlich, die er in einem reinen Handwerksbetrieb mit zwei, drei Gehilfen erzielte. Seine Erfolge fanden auch durch seine Bestellung zum Universitätsmechanikus im Jahre 1860 Anerkennung. In seiner Bewerbung konnte sich Carl Zeiß u.a. auf die Gutachten des Ordinarius für Physik und Mathematik, Karl Snell, und des Extraordinarius Hermann Schäffer stützen, beide in Jena die wichtigsten Universitätslehrer von Ernst Abbe und später auch Lehrer von Gottlob Frege. 1863 folgte dann die Ernennung zum Hofmechanikus, nachdem ihm bereits 1861 auf der Allgemeinen Thüringischen Gewerbeausstellung ein erster Preis und die goldene Medaille für seine Produkte verliehen worden war. Carl Zeiß wollte die exakten Wissenschaften, deren technologische Wirksamkeit sich bereits in vielen Bereichen erwiesen hatte und deren sichere und präzise Methoden er in seinen eigenen Universitätsstudien kennengelernt hatte, endlich auch für die Fertigung optischer Instrumente nutzen. Schon Anfang der 50er Jahre arbeitete er deshalb mit dem Mathematiker Barfuß zusammen, der bereits von seinem Jenenser Lehrmeister Körner zur Berechnung von Fernrohrobjektiven herangezogen worden war. Wie bei Körner versagte Barfuß aber auch bei Zeiß. Die Zusammenarbeit mit Barfuß fand durch dessen Tod 1854 ein natürliches Ende. Die Mißerfolge mit Barfuß waren für Zeiß aber kein Anlaß, seine Idee der wissenschaftlich begründeten Fertigung optischer Instrumente aufzugeben. Er verstärkte seine eigenen wissenschaftlichen Studien, besuchte die Vorlesungen von Hermann Schäffer, hatte aber andererseits ein durchaus gut gehendes Unternehmen zu leiten und mußte sich dort auch um den unmittelbaren Fertigungsprozeß kümmern. Carl Zeiß kam schließlich zu der Überzeugung, daß er allein nicht in der Lage sein würde, die für seine technologischen Bedürfnisse passenden wissenschaftlichen Grundlagen zu finden und auszubauen. In dieser Situation kam Zeiß der Zufall zuhilfe. Im Jahre 1863 war nämlich Ernst Abbe nach Jena zurückgekehrt und benötigte, nachdem er sich im August habilitiert hatte, für ein im November beginnendes Kolleg einige Instrumente, die er natürlich bei dem allseits geschätzten Universitätsmechanikus Zeiß bestellte. So wurde Carl Zeiß auf den technisch interessierten und hochbegabten jungen Naturwissenschaftler und Mathematiker aufmerksam, von dem außerdem zu erwarten war, daß er längere Zeit an der Jenenser Universität bleiben würde. Ernst A bbe
Ernst Abbe um 1880
Ernst Carl Abbe wurde am 23. Januar 1840 in Eisenach geboren. Sein Vater, Georg Adam Abbe, erlernte den Beruf des Buchdruckers, gab diesen aber 1838 auf und wurde Arbeiter in der Kammgarnspinnerei Eichel & Kramer. Mit seiner Tüchtigkeit, die sich auch auf ausgeprägte geistige Beweglichkeit stützte, entwickelte er sich in wenigen Jahren zum Spinnmeister und wurde schließlich Fabrikaufseher, ohne daß sich dadurch die sehr bescheidene, materielle Situation der Familie geändert hätte. Trotz seiner geringen materiellen Mittel unternahm Georg Adam Abbe aber alles, um seinem schon früh als begabt erkannten Sohn durch gute Bildung den sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Von 1846 bis 1850 besuchte Ernst Abbe die Volksschule und von 1850 bis 1857 die Realschule in Eisenach. Materiell erleichtert wurde dies durch Schulgeldfreiheit und seit 1854 durch ein landesherrliches Stipendium. Bereits während seiner Schulzeit war Abbe Mitglied eines wissenschaftlichen Schülerzirkels, in dem er das Gebiet der Mathematik, Physik und Astronomie vertrat. "Er konnte nicht müde werden, seinen Freunden die Wunder der Mathematik an Formeln und Figuren vorzuführen und sie zu überzeugen, daß die Mathematik durchaus nicht trocken, sondern herrlich und zauberhaft wäre." (Auerbach, 38) Noch als Schüler studierte Abbe Werke des berühmten Mathematikers Carl Friedrich Gauß (1777-1855), was für einen Realschüler nicht nur wegen der Kompliziertheit des Stoffes ungewöhnlich war, sondern auch deshalb, weil diese Werke in Latein abgefaßt waren, Abbe sich aber als Realschüler Latein nur neben dem üblichen Schulpensum aneignen konnte. Bei seinen schulischen Erfolgen und seinem Interesse für wissenschaftliches Arbeiten verwundert es nicht, daß Abbe einigen seiner Mitschüler Privatunterricht erteilte und so eine kleine materielle Unterstützung für die Familie erarbeiten konnte. Bereits in Eisenach wurde es Abbe möglich, beachtliche handwerklich-technische Interessen und Fertigkeiten auszubilden. Er war regelmäßiger Gast in der mechanischen Werkstatt des Stadtrichters Trunk, in der er sich auch in der Arbeit an der Drehbank übte. Bemerkenswert ist die Art, wie Abbe die Schule absolvierte (Auerbach, 39f.): Laut Schulgesetz mußte ein Schüler die Schule acht Jahre lang besuchen: Je ein Jahr von Sexta bis Tertia und dazu je zwei Jahre in Sekunda und Prima. Wegen seiner besonderen Befähigung hat Abbe die Schule nach nur sieben Jahren verlassen: sämtliche Lehrer hatten sich damit einverstanden erklärt, ihm das zweite Jahr der Prima zu erlassen und ihn damit ein Jahr vorfristig zur Reifeprüfung zuzulassen. Um nun aber nicht in formalen Konflikt mit dem Schulgesetz zu geraten, entschied man sich, ihm auf dem Abgangszeugnis doch den Besuch von zwei Jahren Prima zu attestieren. So gelang es Abbe in nur sieben Jahren von 1850 bis 1857 acht Jahre Schule zu absolvieren. Abbe war auch der erste, der eine für die damalige Zeit bemerkenswerte Regelung nutzte: Am 17. 12. 1856 hatte das Großherzogliche Staatsministerium der Schule die Befugnis erteilt, "aus ihrer Prima solche Schüler mit dem Zeugnis der Maturität für die Universität zu entlassen, welche sich dem Studium Mathematik und der Naturwissenschaften widmen wollen; und zwar wenn und solange die Überzeugung besteht, daß sie in der genannten Klasse die dazu genügende Vorbildung erhalten haben." (Auerbach, 40) Abbes Lebensweg hat in kaum zu überbietender Weise gezeigt, wie sinnvoll diese Regelung war. Im April 1857 wurde Ernst Abbe unter der Fächerbezeichnung "Mathematik" in Jena immatrikuliert. In den in Jena verbrachten zwei Studienjahren hörte er Physik und Mathematik bei Snell und Schäffer, Botanik bei Schleiden, Philosophie, Logik und Psychologie bei Apelt, Ästhetik bei Fischer, Neueste Geschichte bei Droysen und Pädagogik bei Stoy. Sein Studienweg war auf die Höhere Lehrerlaufbahn ausgerichtet. Schon bald wurde er durch seine wissenschaftlichen Interessen und den Rat seiner Lehrer Snell und Schäffer angeregt, seine Lebensplanung auf eine akademische Laufbahn auszurichten. Für beide Laufbahnen war es notwendig, Jena nach vier Semestern zu verlassen: Jena verfügte nicht über die für die Lehrerlaufbahn notwendige Prüfungskommission, und außerdem war es in Jena unmöglich, Mathematik in ihren höheren Bereichen auf modernstem Stand zu studieren. Auf Anraten von Snell und Schäffer wechselte Abbe deshalb den Studienort und setzte sein Studium in Göttingen fort, das, nachdem bis 1855 Gauß dort gelehrt hatte, auch zu Abbes Zeiten in Deutschland die modernste Mathematikausbildung bot. Snell und Schäffer versprachen sich von Abbes Wechsel nach Göttingen auch, daß dieser dann gerade die in Jena vorhandene Lücke auf dem Gebiet der modernen Mathematik schließen könne, wozu sie sich selbst schon nicht mehr in der Lage sahen. Anlaß für diese hohen Erwartungen bot neben den allgemeinen Studienleistungen Abbes auch die Lösung einer Preisaufgabe Darstellung des Zusammenhangs, der bei Gasen zwischen Volumen- und Temperaturänderung besteht, wenn Wärme weder zu- noch abgeführt wird, für die ihm im Universitätsjubiläum 1858 der erste Preis von 50 Talern zuerkannt wurde. Für eine spätere Arbeit zur mathematischen Begründung des Foucaultschen Pendelversuchs erhielt er weitere 20 Taler. Im Zusammenhang mit der Lösung der beiden Preisaufgaben bewilligten die Eisenacher Fabrikherren ein Stipendium, das ihm während seines weiteren Studiums zur Verfügung stand. Nach Auerbachs Bericht fällt die erste Begegnung Abbes mit Carl Zeiß bereits in Abbes Studentenzeit: "Abbe hat im dritten Semester seiner Studienzeit analytische Optik bei Snell gehört und sich bereits um die praktische Seite dieser Angelegenheit gekümmert, denn er wurde mit Carl Zeiß bekannt und ging mitunter in die Werkstatt, um sich dort zu informieren und auch selbst zu erproben. Und bereits in seiner Studentenzeit konstruierte er 1859 ein kleines Taschenmikroskop." (Auerbach, 65) Abbe war also kein Unbekannter für Zeiß, als er 1863 als junger Doktor nach Jena zurückkehrte.
Ernst Abbe um 1863 Dazwischen lag seine Studienzeit in Göttingen und sein Jahr als Dozent am Institut des Physikalischen Vereins in Frankfurt. In Göttingen vervollkommnete Abbe seine mathematischen und physikalischen Kenntnisse durch Vorlesungsbesuche bei Bernhard Riemann, Wilhelm Weber, Moritz Stern und Ernst Schering. Eine Vorlesung zur Optik bei Listing, der nur selten und ungern las, kam überhaupt nur durch Abbes Initiative zustande: "... so trommelte Abbe die nötige Zahl von Hörern zusammen, um Listing aus seiner Ruhe herauszustöbern." (Auerbach, 72) Bei dem schon als Freges Lehrer erwähnten Hermann Lotze hörte Abbe Psychologie. Abbe promovierte am 23. März 1862 in Göttingen mit einer Arbeit zur theoretischen Physik, deren Thema dem der in Jena gelösten Preisaufgabe sehr ähnlich war. Diese Arbeit erhielt von Wilhelm Weber eine sehr günstige Beurteilung: "Die von Herrn Abbe vorgelegte Abhandlung: 'Erfahrungsmäßige Begründung der Äquivalenz zwischen Wärme und mechanischer Arbeit' ist eine vorzügliche Arbeit, worin die erfahrungsmäßige Grundlage der mechanischen Wärmetheorie klar und scharfsinnig entwickelt ist. Sie füllt eine Lücke in der Wärmelehre aus, in welcher der Satz von der Äquivalenz der Wärme mit mechanischer Arbeit bisher ohne erfahrungsmäßige Begründung eingeführt, bloß durch viele bewährte Folgerungen, Geltung erlangt hatte." (Auerbach, 88). Die Dissertation verdeutlicht Abbes Interesse an Fundierungsproblemen der Wissenschaft, das später Freges ganzes wissenschaftliches Schaffen bestimmen sollte. Abbe lieferte in seiner Arbeit nicht primär einen Beitrag zur weiteren empirischen Bestätigung einer bekannten Theorie durch Prüfung von aus dieser Theorie ableitbaren Erfahrungssätzen, sondern sein Ziel war die Erklärung der Theorie. Er wollte zeigen, warum es sich so verhält, wie in der Theorie behauptet, wobei er sich nicht auf die empirische Bestätigung der Theorie, den Nachweis, daß es sich so verhält wie in der Theorie behauptet, beschränken konnte: "Abbe unterscheidet hinsichtlich der Verknüpfung der Theorie mit den Tatsachen zwei Methoden; die regressive und die progressive; bei jener steigt man von dem vorweg genommenen Prinzip zu den speziellen Folgerungen hinab, die einer experimentellen Kontrolle fähig sind, bei dieser geht man von den Erscheinungen selbst aus und leitet aus ihnen das Prinzip wirklich ab; offenbar ist der letztere Weg wesentlich genußreicher und befriedigender." (Auerbach, 88) Eigentlich hatte Abbe beabsichtigt, von Snell und Schäffer darin bestärkt, das Doktorexamen in Jena (für Sommer 1863) abzulegen und dann unmittelbar die Habilitation anzuschließen. Über diesen Plan berichtet er seinem Freund Martin Schütz in einem Brief vom 2. Oktober 1860 zum Verlauf eines Kurzbesuches in Jena: "Die Ergebnisse will ich Dir kurz damit zusammenfassen: ich hoffe, daß ich Dir Ostern in 2 Jahren einen Index scholarum der Großherzogl.-Herzogl. Sächsischen Gesamtuniversität Jena werde zuschicken können, darin Du unter der Rubrik 'III. privatim docentes' einen gewissen D. Ernestus Abbe aufgeführt finden wirst."FN3 Vor seinem Besuch in Jena hatte Abbe mit seinem Schulfreund Martin korrespondiert, um sich nach der Möglichkeit des Beginns einer akademischen Karriere in Berlin zu erkundigen. Die Auskünfte Martins waren aber wenig ermutigend. "Ich habe daher in aller Stille meinen früheren Gedanken wieder aufgenommen - nämlich zu versuchen, mir in Jena irgend ein Plätzchen zu verschaffen, um nebenbei in eine akademische Thätigkeit einzurücken. Der alte Snell kam mir in diesem Projecte bereitwillig entgegen - nahm es mir geradezu aus dem Munde heraus - und suchte mich in jeder Weise in diesem Vorsatze zu bestärken, indem er mir vorhielt, daß jetzt in Jena gar Niemand sei, der speciellere Theile der Mathematik vortrage, während doch das Bedürfnis dessen vorliege u.s.f.. Freilich steht mir dabei für die erste Zeit wenigstens, auch keine besonders glänzende Stellung bevor; ich muß sehen, in einem dortigen Privatinstitut von Zenker als Lehrer unter zu kommen. Zwar habe ich hierzu unmittelbar keine Schritte thun können, da der Inhaber, Zenker, nicht in Jena war; indeß meine Snell u. besonders Schaeffer (der mit dem Mann in näherer Verbindung steht), daß dies keine Schwierigkeiten haben werde." (Abbe, 55f.) Die Verehrung für Weber und Riemann und die Aussicht auf ein Amt in Frankfurt, von dem sich Abbe auch eine gewisse materielle Sicherung versprach, brachten ihn schließlich von diesem Plan ab. Wie bereits als Schüler in Eisenach und als Student in Jena, verdiente sich Abbe auch in Göttingen einen Nebenerwerb durch Privatunterricht, ohne den er sein Studium nicht hätte finanzieren können. Die Aussicht auf eine gesicherte Besoldung war für Abbe bei seiner Entscheidung für Frankfurt ganz sicher nicht von untergeordneter Bedeutung, auch wenn seine auf Popularisierung von Ergebnissen der Physik gerichtete Aufgabe dort weder seinen wissenschaftlichen Plänen noch seinen Fähigkeiten angemessen war. Es verwundert deshalb nicht, daß Abbe die Stelle in Frankfurt schon nach einem Jahr wieder aufgab und nach Jena zurückkehrte, um dort zu habilitieren, nachdem ihm eine Stiftung des Frankfurter Privatgelehrten und Bankiers Michael Reiss die dafür nötigen finanziellen Mittel zu Verfügung stellte. Zur Ergänzung dieser Mittel nahm er nach seiner Rückkehr nach Jena neben seiner Tätigkeit als Privatdozent eine Lehrerstelle an - zwar nicht an dem in Aussicht genommenen Privatinstitut von Zenker, sondern an der Privatschule seines ehemaligen Lehrers Stoy. Aber auch damit war sein Lebensunterhalt nicht mehr in einer erträglichen Weise zu gestalten. Abbe sah den einzigen Ausweg darin, seine Universitätskarriere abzubrechen, das Staatsexamen für den höheren Schuldienst abzulegen und sich anschließend an einem Realgymnasium um eine Lehrerstelle zu bewerben. Er teilte diesen Entschluß dem Kurator Moritz Seebeck mit. Dieser setzte seinen Einfluß für den jungen Privatdozenten ein, von dessen großer Befähigung er überzeugt war und sicherte Abbe bei der Staatsregierung eine jährliche Unterstützung von 200 Talern, die dann auf 300 und schließlich auf 500 Taler erhöht wurde. Wohl hatten sich auch Snell und Schäffer in dieser Situation für Abbe eingesetzt, aber es war letztlich Seebecks Verdienst, Abbe der Wissenschaft und Jena mit allen damals nicht absehbaren Folgerungen erhalten zu haben.
Universitätskurator Moritz Seebeck Abbes späterer Kollege Auerbach, der selbst von Abbe auch materiell gefördert wurde, würdigt Seebecks weitsichtige Tat folgendermaßen: "Hier haben wir einmal ein glänzendes Beispiel vor uns für die ungeahnten Konsequenzen unscheinbarer Mittel: Gerade im nächsten Jahre bahnten sich die Beziehungen zwischen Abbe und dem Optiker Zeiß an; und wenn damals nicht Abbe durch eine an sich lächerlich kleine Summe Geldes gehalten worden wäre, hätte er seine Tage als ein wahrscheinlich tüchtiger, aber in weitesten Kreisen unbekannter Schullehrer beschlossen. Jena wäre nicht der Sitz einer neuartigen Industrie geworden und die Universität Jena, das kann man getrost sagen, würde nicht mehr bestehen. Mit Recht sagt daher ein Verehrer Abbe's (Max Vollert, der zur Zeit [1918] des Seebeck'schen Amtes waltet): 'Wohl nie hat eine staatliche Unterstützung reichere Zinsen getragen.'" (Auerbach, 133f.) Und wenn man die Bedeutung Abbes für Frege betrachtet, ist es müßig, auseinanderzusetzen, daß Freges Werk in Jena ohne Seebecks Eintreten für Abbe wohl kaum geschaffen worden wäre.
Stadt der Optik und des Glases
Zeiß-Werkstätte 1871 Durch Abbes Bleiben in Jena konnte am 3. Juli 1866 zwischen ihm und Carl Zeiß vereinbart werden, daß Abbe in Zukunft die Zeißsche Werkstätte bei der wissenschaftlichen Fundierung des Mikroskopbaues unterstützen werde. Kurz vorher, am 28. Mai, hatte Zeiß mit seinen 20 Angestellten die Fertigung des 1000. Mikroskops feiern können. Von Abbe versprach er sich grundsätzliche Änderungen der Fertigungungsart, die den wirtschaftlichen Erfolg längerfristig sichern sollten. Abbe hatte in den drei Jahren, die er wieder in Jena weilte, häufig die Zeiss-Werkstätte besucht und dabei auch seine handwerklichen Kenntnisse und Fertigkeiten, z.B. bei der Arbeit an der Drehbank, unter Beweis gestellt. Daß Abbe dazu auch ein hervorragender Theoretiker war, hatte sich im kleinstädtischen Jena schnell bis zu Zeiß herumgesprochen. Sicher wußte Zeiß auch, daß Abbe bis zu dieser Zeit seinen wissenschaftlichen Schwerpunkt nicht auf dem Gebiet der Optik hatte. Abbe konnte also kaum auf von ihm bereits Erreichtes zurückgreifen, und Zeiß verband das Schicksal seiner Werkstätte so mit dem Risiko, das mit der Suche nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen verbunden ist. Aber dieses Risiko wurde schnell und in immer höherem Maße belohnt: "Jedenfalls änderte sich in der Werkstatt so ziemlich alles, was die Arbeitsmethode betraf: außer einer zweckmäßigen Arbeitszerlegung wurde durch scharfe Kontrolle die Präzision namentlich bei den Optikern gesteigert. Die Folge war, daß bereits 1869 nicht nur neue Schleif- und Poliermethoden eingeführt und die Zahl der hergestellten Instrumente vermehrt, sondern ihr Preis um ca. 25% gesenkt werden konnte. Im gleichen Jahre ließ Abbe für seinen Freund Dohrn den 'Abbeschen Beleuchtungsapparat' bauen und fand die homogene Immersion; es folgte der Bau der Refraktometer, die die Bestimmung der Brechzahlen und optischen Grundwerte der Zerstreuung bei festen und flüssigen Stoffen ermöglichen, und des Apertometers zur Messung der Öffnungswinkel. Abbe begann auch die Erforschung der optischen Gesetze: er fand, daß für den Durchgang der Lichtstrahlen durch die Linsen außer den Brechungsgesetzen auch die der Beugung des Lichts in Frage kommt, was ihn dann zur Aufstellung des 'Abbeschen Sinussatzes' brachte." (Koch, 271) Der Erfolg ist auch an der Steigerung der Beschäftigtenzahlen und den Produktionszahlen im Zeiss-Unternehmen abzulesen, die sich innerhalb von 15 Jahren vervierfachten:
1886 wurde mit bereits 300 Arbeitern die Fertigung des zehntausendsten Mikroskops gefeiert. 1892 schließlich konnte die Produktion des zwanzigtausendsten Mikroskops begangen werden. Da danach das Zeiss-Unternehmen zum Großbetrieb geworden war, dessen Produktion den Rahmen einer Mikroskopfabrik weit überschritt, wurden weitere Zählungen und entsprechende Feiern nicht mehr durchgeführt.FN4 Seit 1876, dem Jahr, in dem das 3000. Mikroskop gefertigt wurde (die anfangs produzierten einfachen Mikroskope mitgerechnet), hatten Zeiß und Abbe ihre Zusammenarbeit auf eine neue geschäftliche Grundlage gestellt. Bis 1875 war Abbe von Zeiß ohne feste Grundlage mit Tantiemen von 5 bis 20% vom Erlös der gefertigten Mikroskope honoriert worden. Abbe entschloß sich am 19. Mai 1875, Carl Zeiß vorzuschlagen, die Zusammenarbeit auf eine verbindlichere Grundlage zu stellen. Carl Zeiß nahm die Abbesche Anregung freudig auf und schlug seinerseits vor, Abbe solle stiller Teilhaber am Geschäft werden. Er ließ sich dabei offensichtlich von mehreren Erwägungen leiten. Einmal war damit der Dank für die von Abbe bisher für Unternehmen gebrachten Leistungen verbunden. Zum anderen wurde dadurch das weiter bestehende wirtschaftliche Risiko verteilt, das Zeiß - in völliger Abhängigkeit von Abbe - bisher allein zu tragen hatte, und schließlich die wichtigste Erwägung: Zeiß konnte so eine Form finden, Abbe dauerhaft an das Unternehmen zu binden. Abbe hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, seine akademische Laufbahn, die ihn 1870 zum außerordentlichen Professor, 1877 zum Direktor der Sternwarte und am 25. Juli 1878 zur Berufung zum ordentlichen Honorarprofessor geführt hatte, weiter fortzusetzen und war dabei auch nicht auf Jena angewiesen gewesen. 1878 hatte Helmholtz Abbe vorgeschlagen, an dem neu eröffneten großen physikalischen Institut Abteilungsvorsteher zu werden und außerdem an der Universität eine Spezialprofessur für Optik zu übernehmen - Vorschläge, die Abbe sehr reizten, die er aber wegen der mit Zeiß eingegangenen Bindung genauso ablehnte wie das Angebot, eine ordentliche Professur in Jena zu übernehmen. Statt dessen begnügte er sich mit einer weniger verpflichtenden außerordentlichen Honorarprofessur. In einem Brief vom 8. 1. 1879 an Anton Dohrn beschreibt Abbe diese Entwicklungen: "Meine Stellung hier hat im Laufe dieses Jahres auch nach Aussen hin die mir erwünschte Klarheit erlangt. Im Frühjahr war Helmholtz persönlich hier, um mich ... für eine Special-Professur für Optik an die Berliner Universität zu engagieren. Ich will nicht leugnen, dass ich diesen mir geradezu auf den Leib geschnittenen Posten mit schwerem Herzen, wenn auch natürlich ohne das geringste Bedenken, abgelehnt habe. Um so leichter ist es mir dafür geworden, den Antrag, in die hiesige Fakultät einzutreten, zu beantworten; und so hat man mich im letzten Sommer definitiv und in aller Form als Honorar-Professor in das eiserne Inventar der Universität eingereiht."FN5
Anton Dohrn Abbe ging auch nicht nach Marburg, wo er Professor für Physik und Direktor des physikalischen Instituts geworden wäre. Diese Entscheidungen sind ihm ohne Zweifel leichter gefallen, weil die Entwicklung bei Zeiß nach seinem Eintritt als Gesellschafter sehr erfreulich verlief. Das wird auch im schon zitierten Brief an Dohrn deutlich: "Bei Zeiss geht es in letzter Zeit sehr gut. Wir sind seit einem Vierteljahr stets im Gedränge, um den Bestellungen entsprechen zu können. Namentlich die neuen Objektive (Oel-Immersion) - von denen Sie, schändlicher Weise immer noch kein Exemplar erhalten haben, weil die fertig werdenden abgehen wie die warmen Semmeln - [haben] das Prestige der Werkstatt in Deutschland und ausserhalb stark gehoben. Im letzten Jahr haben wohl alle Berliner Institute, bei denen wir bisher noch gar keinen Fuss gefasst hatten, grosse Mikroskope hier bestellt." (Abbe) Der zwischen Abbe und Carl Zeiß geschlossene Gesellschaftervertrag trat am 15. Mai 1875 in Kraft und erhielt am 22. Juli 1876 seine endgültige Fassung. Die wichtigsten Bestimmungen daraus waren folgende (Auerbach, 218-220): Abbe tritt in die Firma Zeiß als Kommanditist ein und beteiligt sich mit einer Vermögenseinlage von 33000 Mk an dem Unternehmen, dessen Gesamtwert mit 66000 Mk berechnet wurde. Zeiß verpflichtet sich, sein gesamtes Arbeitsvolumen dem Unternehmen zu widmen, Abbe sollte dagegen diejenige Zeit und Kraft aufwenden, welche ihm nach dem aktuellen Umfange seiner akademischen Tätigkeit übrig bliebe. "Herr Prof. Abbe verzichtet im Voraus auf eine Steigerung seines bisherigen Lehrberufs, insbesondere auf die Annahme einer ordentlichen Professur ... Dabei ist kein Gesellschafter befugt, für die im Geschäfte geleisteten Dienste, sie mögen selbst in der Konstruktion neuer Erfindungen, in der Lösung wichtiger Berechnungen, in der Verbesserung der Methoden beruhen, eine besondere Vergütung zu beanspruchen ..." (Auerbach,219 ) Mit diesen Klauseln war es Carl Zeiß gelungen, Abbe vollständig in das Unternehmen einzubinden. Dafür erhielt Abbe bis zum 15. Mai 1885 40% und Carl Zeiß 60% vom jährlichen Reingewinn, danach standen den beiden Gesellschaftern jeweils 50% des Reingewinns zu. Den Vertragsbedingungen entsprechend wurde der Sohn von Carl Zeiß, Dr. Roderich Zeiß, 1879 Gesellschafter des Unternehmens. Im Juli 1883 wurde der Vertrag aktualisiert und festgelegt, daß die Zeiss-Partei und Abbe jeweils Besitzer der Hälfte des gesamten Firmenvermögens sind. Die Gewinnbeteiligung sah für die beiden Zeiß 55% und für Abbe 45% vor, solange noch beide Zeiß im Geschäft tätig waren. Für die Zeit danach war eine Quote von jeweils 50% vereinbart worden. Als der Vertrag geschlossen wurde, hatte Abbe die entscheidenden wissenschaftlichen Grundlagen des Mikroskopbaues entwickelt und in die Fertigung umgesetzt. Dabei war auch Abbe nicht von Mißerfolgen verschont geblieben, denn die in den ersten Jahren von ihm konstruierten Mikroskopobjektive erreichten völlig unerwartet häufig nicht die Leistungsfähigkeit der nach der alten Methode des "Probelns" gefertigten Objektive. Der entscheidende Durchbruch kam dann mit Abbes Erkenntnis, daß für die mikroskopische Abbildung die Beugung des Lichts an der Objektstruktur von besonderer Bedeutung ist. Abbe erkannte, daß das Auflösungsvermögen eines Objektivs mit kleinerer Lichtwellenlänge und größerer numerischer Apertur - das ist das Produkt aus Sinus des halben Öffnungswinkels des Objektivs und der Brechzahl des zwischen dem Objektiv und dem zu betrachtenden Objekt befindlichem Mediums - zunimmt. Darauf gestützt konnte das Unternehmen im Prospekt vom August 1872 vierzehn neue Trockensysteme und drei unterschiedliche Immersionssysteme mit der Mitteilung anbieten, diese Systeme seien auf Grund theoretischer Berechnungen Ernst Abbes in Jena konstruiert worden. Das von Carl Zeiß angestrebte Ideal einer Mikroskopproduktion auf tragfähiger wissenschaftlicher Grundlage war nun auch für die Öffentlichkeit sichtbar erreicht. Aber natürlich war noch nicht das Ideal der auf dieser Grundlage produzierbaren Mikroskope verwirklicht, denn schnell wurde klar, daß entscheidende Verbesserungen davon abhängen würden, ob es gelingen würde, neben den bisher als optischen Gläsern benutzten Flint- und Kronglas kontrolliert neue optische Gläser mit spezifischen Eigenschaften zu produzieren. Das war eine Aufgabe, der die vorhandene Glasindustrie weder in Deutschland noch im Ausland gewachsen war. Mit Adolf Ferdinand Weinhold (1841-1917), seinem Studienfreund aus Göttinger Tagen, der inzwischen Professor für Physik an den Technischen Lehranstalten Chemnitz geworden war, erörterte Abbe 1876/77 sogar die Möglichkeit der Herstellung von Linsen aus organischen Stoffen, insbesondere wurde Styrol (heute meist als "Styren" bezeichnet) in die engere Wahl gezogen.FN6 Im Briefwechsel mit Weinhold wird am 12. 3. 1881 von Abbe seine neu geknüpfte Verbindung mit Otto Schott (1851-1935) angesprochen, aus der schließlich durch die Entwicklung von Gläsern mit genau bestimmbaren optischen Eigenschaften die endgültige Lösung des Materialproblems für die wissenschaftlich fundierte Mikroskopentwicklung erwachsen sollte: "Ein sehr tüchtiger Chemiker (ein Dr. O. Schott in Witten i. Westf.), der mit der Glastechnik vertraut ist, will Versuche anstellen, über die Herstellbarkeit von Glasflüssen mit anderen optischen Eigenschaften als die gewöhnlichen Crown- u. Flintgläser besitzen. Ich habe es übernommen, ihm dabei mit den erforderlichen Apparaturen u. dergl. zur Hand zu gehen." Mit Otto Schott hatte Abbe einen Partner gefunden, der als Kind eines Glasmachers bereits seit seiner Studienzeit an der Technischen Hochschule Aachen, der Universität Würzburg und der Universität Leipzig in seinem Chemiestudium der Zusammensetzung und Herstellung von Gläsern besondere Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Im anschließenden Promotionsverfahren kam Schott erstmals mit Jena in Kontakt, denn Schott promovierte 1875 mit der Dissertation Beiträge zur Theorie und Praxis der Glasfabrikation an der Jenaer Philosophischen Fakultät, der zu dieser Zeit auch Abbe angehörte. Der erste Kontakt zwischen Abbe und Schott kam dann 1879 zustande, als Schott Abbe brieflich bat, die Brechungs- und Zerstreuungswerte eines von ihm geschmolzenen Lithiumglases zu prüfen. Obwohl die ersten Proben so ungenügend ausfielen, daß es nicht möglich war, deren optische Eigenschaften festzustellen, ermutigte Abbe Schott zur Weiterarbeit. Am 4. Januar 1881 hatte sich der Kontakt zwischen Abbe und Schott soweit entwickelt, daß bei einem Besuch Schotts in Jena ein gemeinsamer Arbeitsplan festgelegt wurde. Nach einem Jahr äußerst intensiver Zusammenarbeit, in dem nicht weniger als 171 Briefe und Berichte zwischen Schott, der sein Laboratorium in Witten betrieb, und Abbe ausgetauscht wurden, übersiedelte Schott schließlich im Januar 1882 nach Jena. Dort gründete Schott nach zwei weiteren Vorbereitungsjahren und mit Hilfe einer preußischen Subvention gemeinsam mit Abbe, Carl und Roderich Zeiß am 1. September 1884 das Glastechnische Laboratorium Schott & Genossen. Hieraus ging später das Jenaer Glaswerk Schott & Gen. hervor, in dem die benötigten optischen und andere Industriegläser in Massenproduktion hergestellt werden konnten. Bereits 1886 wurde von der Firma Carl Zeiß eine Kollektion Neue Mikroskop-Objektive und Okulare aus Spezialgläsern des Glastechnischen Laboratoriums Schott & Gen. vorgestellt. Im Jahr 1899 wurde die Produktpalette dann auch auf astronomische Instrumente mit Objektiven aus Gläsern der Firma Schott erweitert. Die Verbindung von Wachstum der Stadt Jena, der Universität, dem Zeißwerk und dem Glaswerk Schott & Gen. wird in folgender Übersicht deutlich:
FN2 Vgl.: Auerbach, Felix: Ernst Abbe. Sein Leben, sein Wirken, seine Persönlichkeit, Leipzig 1918, S. 49. FN3 Abbe, Ernst: Briefe an seine Jugend- und Studierfreunde Carl Martin und Harald Schütz 1858-1865. Berlin 1986, S. 55. FN4 Vgl.: Schomerus, Friedrich: Vor 50 Jahren wurde das 20000. Zeiss-Mikroskop fertiggestellt. In: Zeiss Werkzeitung, Neue Folge, Jg. 17 (1942), S. 88f. FN5 Abbe, Ernst: Brief an Anton Dohrn vom 8. Januar 1879. In: Abbe an seinen Freund Prof. Dr. Dohrn, Neapel, 26. 1. 1877 - 17. 1. 1879, Archiv der Carl Zeiß GmbH. FN6 Vgl.: Abbe, Ernst: Briefwechsel mit Adolf Ferdinand Weinhold. Eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Reinhard Feige und Irmgard Szöllosi, Leipzig 1990, S. 24. FN7 Eingemeindung Wenigenjenas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ernst Abbes Stiftungswerk
Mit dem quantitativen Wachstum des Zeiss-Unternehmens und von Schott & Genossen steigerten sich auch die erzielten Gewinne erheblich. Ernst Abbe verfügte damit in immer höherem Maße über die Mittel, um bezogen auf die Unternehmen, die Universität und die Stadt Jena seine sozialpolitischen Vorstellungen zu verwirklichen, die dann in der Stiftungsidee kulminierten. In seinen sozialpolitischen Bemühungen ließ sich Abbe von zwei Hauptideen leiten: "Erstens die Auffassung von den durch das öffentliche Interesse bedingten Pflichten des industriellen Großbetriebs und [zweitens] der Gedanke der Gerechtigkeit, der die Beziehungen des Unternehmers zu allen Arbeitern beherrschen soll."FN1 Für Abbe hatte der Unternehmer eine öffentliche Funktion zu erfüllen, die in der Verwaltung der nationalen Arbeitskraft in der Wirtschaftstätigkeit des Volkes besteht. Insofern hatte er nicht nur ein partikulares privates Interesse zu vertreten, sondern eine nationale Aufgabe zu erfüllen. Abbe war deshalb auch ein entschiedener Gegner der Klassenkampfidee. Auf Basis des von ihm angestrebten Interessenausgleichs zwischen Arbeitern und Unternehmern konnte die Losung nicht sein, "Arbeiter gegen Unternehmer", sondern "fortgeschrittene Arbeiter und fortgeschrittene Unternehmer gegen rückständige Arbeiter und rückständige Unternehmer". Er ging von der festen Überzeugung aus, daß die Erträge der Unternehmen auch dem Fleiße der Arbeiter zu verdanken seien, woraus sich ein Anspruch an Beteiligung am Reingewinn ableite. Zugleich achtete er den Beitrag des Unternehmers und die Bedeutung der geistigen Arbeit für das Unternehmen sehr hoch. Interessenausgleich bedeutet für ihn deshalb nicht Mitbestimmung in dem Sinne, daß jeder Werksangehörige die gleichen Rechte bei der Bestimmung der Unternehmenspolitik und der Unternehmensleitung habe. Für ihn war "der einfältigste Unternehmer immer noch der gescheitesten Genossenschaft voraus."FN2 Abbe sah es als glücklichen Umstand an, daß er sich im Studium und durch die Arbeit an der Universität die geistigen Voraussetzungen herausbilden konnte, auf deren Basis er sein wissenschaftliches und unternehmerisches Werk schaffen konnte. Er hatte aber auch die gravierenden Unzulänglichkeiten der Universität kennengelernt, und so sah er es jetzt, nachdem er über die nötigen Mittel verfügte, als seine Dankespflicht an, der Jenaer Universität ihren Anteil an seinem Aufstieg nun materiell zu danken, zumal er sich von einer solchen Hilfe nicht nur wünschenswerte Rückwirkungen auf das eigene Werk versprach, sondern hierin ein Mittel sah, die geistigen Ressourcen der Nation in umfassender Weise zu entwickeln und zu nutzen. In Anbetracht der von ihm selbst durchlebten schwierigen Situation nahezu mittelloser junger Privatdozenten, des erbärmlichen Zustands der Institute, Laboratorien und der allgemeinen Ausstattung, suchte er nach einem Weg, der Universität in einer Weise zu helfen, die den Prozeß der Entwicklung einer modernen, konkurrenzfähigen Universität effektiv fördern sollte. Abbe hatte in seiner eigenen Entwicklung und durch langjährige Kenntnis der Universität erfahren, daß wissenschaftliche Bedeutsamkeit und Honorierung durch öffentliches Interesse und materielle Vergütung nicht immer übereinstimmten. Das Beispiel Gottlob Freges stand ihm dabei unmittelbar vor Augen. Wie Koch hervorhebt, "... empfand es Abbe als ungerecht, daß einige seiner Universitätskollegen neben ihren langsam ansteigenden Gehältern und Honoraren aus literarischer Tätigkeit auch noch Bezüge aus der Nutzung ihrer Erfindungen buchen konnten, was oftmals das Mehrfache ihres Gehalts ausmachte, daß aber gleichzeitig andere Kollegen für ihre mühselig erarbeiteten Werke kaum einen Absatz fanden, weil der Interessentenkreis viel zu eng war."FN3 Es war deshalb für Abbe nur konsequent, daß er im März 1885, nachdem er als Gesellschafter in das Glastechnische Laboratorium Schott & Genossen eingetreten war, auf die 1500 Mark Professorengehalt und die 900 Mark Vergütung als Direktor der Sternwarte verzichtete, obwohl er diese Aufgaben weiter wahrnahm. Der Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke
Ernst Abbe um 1880 Den ersten Schritt zur Gründung der Carl-Zeiss-Stiftung ging Abbe am 13. Mai 1886 mit der Errichtung des Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke. Abbe verpflichtete sich, der Universität vom 1. April an jährlich 6000 Mk für die Förderung der Lehrtätigkeit und der Forschung innerhalb des mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrgebietes zu überweisen. Gefördert werden sollten Lehrkräfte, vor allem Extraordinarien und Privatdozenten, die materielle Ausstattung sollte verbessert werden, es sollte der Bestand der Universitätsbibliothek durch mathematisch-naturwissenschaftliche Literatur aufgestockt werden, und schließlich sollte auch die Jenaer Medizinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft unterstützt werden. Dabei war der Fonds auf solche Maßnahmen gerichtet, die zwar wünschenswert waren, aber nicht mit staatlichen Mitteln finanziert werden konnten. Der Fonds sollte durch das Staatsministerium verwaltet werden. Für die erste Verteilung der Mittel bat er um die Berücksichtigung einiger Vorschläge, von denen einer war, Gottlob Frege so zu unterstützen, daß dieser ein Einkommen von 2000 Mk jährlich erreichen konnte. Eine für Abbe sehr wichtige Forderung bestand darin, daß außer den Unterzeichnern im Staatsministerium, dem Universitätskurator, Abbes Frau und natürlich Abbe selbst niemand etwas von der Quelle des Fonds erfahren sollte. Schon bald machte Abbe auch von dem festgelegten Recht Gebrauch, die Mittelzuweisung zu erhöhen. Bereits am 1. 4. 1888 wurde der Fonds auf 10000 Mk und kurz danach auf 20000 Mk erhöht. Ebenfalls unter dem Siegel der Verschwiegenheit finanzierte Abbe 1887 den Grundstückserwerb und Bau der neuen Sternwarte. Für Abbe war die Errichtung des Ministerialfonds aber nur ein erster und eher unbedeutender Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung seiner sozialpolitischen Vorstellungen in dem Bereich, der unmittelbar von seinen Entscheidungen abhing. Er betrachtete sich eher als zeitweiliger Verwalter des ihm zugefallenen Vermögens, das Nutzungsrecht daran komme aber allen zu, die an seiner Entstehung Anteil haben. Eine Zeitlang neigte er der Idee zu, sein gesamtes Vermögen dem Staat für Universitätsbelange zu stiften. An diesem Verfahren stieß ihn aber dann doch ab, daß sein Unternehmen dann ein Staatsbetrieb geworden wäre, was er als wenig perspektivreich für die weitere Entwicklung des Unternehmens ansah. Die Carl-Zeiss-Stiftung Der dann beschrittene Weg, über eine Stiftung das Unternehmen in eine juristische Person zu verwandeln, der Abbe den von ihm zu entscheidenden Geschäftsanteil und andere Vermögenswerte überlassen werden sollte, beruhte auf einem Vorschlag des Juristen Regierungsrat Dr. Rothe aus dem Staatsministerium Weimar. Der Fortbestand der Stiftung über den Tod des Stifters hinaus sollte nach der Idee Rothes, die Abbe mit Begeisterung aufgriff, durch eine Regelung zur Aufteilung des Abbeschen Erbes, die zwischen Abbe und der Stiftung abzuschließen wäre, gesichert werden. Nach einer notwendigen Verhandlungs- und Ausformulierungsphase wurde am 19. Mai 1889 die Stiftungsurkunde und am 23. und 28. Mai 1889 der Erbeinsetzungsvertrag unterzeichnet. Zwischen diesen beiden Akten bestätigte der Großherzog von Sachsen-Weimar am 21. Mai die Stiftung und erhob sie zur Juristischen Person.
Regierungsrat Dr. Rothe Im Mittelpunkt der Stiftungsurkunde steht die Universität, für die ein weit über den Ministerialfonds hinausgehendes Förderprogramm festgelegt wurde. Grundlage der Stiftung aber sind die Stiftungsbetriebe. Als Zwecke der Stiftung werden im §1 der Stiftungsurkunde festgelegt: "A. Pflege der Zweige wissenschaftlicher Industrie, welche durch die Optische Werkstätte von Carl Zeiss und die Glasschmelzerei der Firma Schott & Gen. unter meiner Mitwirkung in Jena eingebürgert worden sind - durch Anteilnahme an der späteren Verwaltung dieser beiden Institute nach Maßgabe der bestehenden Verträge und der im Folgenden enthaltenen Anordnungen. B. Förderung mathematisch-naturwissenschaftlicher Studien in Forschung und Lehre durch Zuwendung von Mitteln hierfür an die Universität Jena gemäß den nachfolgenden besonderen Bestimmungen."FN4 Die geradezu als Leitmotiv über der Stiftung stehende Verbindung von Wissenschaft und Industrie wird auch durch die in Dankbarkeit und Würdigung der Verdienste von Carl Zeiß im §2 geregelte Namensgebung unterstrichen: "Die Stiftung soll für alle Zeit den Namen Carl-Zeiss-Stiftung führen zu Ehren des Mannes, der zu obengenannten Unternehmungen den ersten Grund gelegt hat, und zur dauernden Erinnerung an sein eigenartiges Verdienst: auf seinem Arbeitsfeld zielbewußt das Zusammenwirken von Wissenschaft und technischer Kunst angebahnt zu haben." Carl Zeiß war am 3. Dezember 1888 verstorben und konnte so nur noch mit seinem Namen in Abbes Stiftungswerk eintreten, für das er die Grundlagen gelegt hatte.
Carl Zeiß Es ist sicher als Zeichen der großen Bescheidenheit Abbes zu werten, wenn er sich selbst der Öffentlichkeit nicht als Stifter präsentieren wollte, und er hat für seine Lebenszeit festgelegte: "Die Stiftung ist s t r e n g g e h e i m z u h a l t e n und zu diesem Behuf auch ihre Wirksamkeit möglichst der Öffentlichkeit zu entziehen. Insoweit es während der angegebenen Zeit einer Bezeichnung der Stiftung überhaupt bedarf, soll man sich statt ihres wahren Namens der Bezeichnung 'Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke' bedienen." Die Festlegungen zum Vermögen der Stiftung unterschieden scharf zwischen Lebzeiten des Stifters und den Mitteln, die mit testamentarischer Festlegung nach dem Tode Abbes bereitgestellt werden sollten. Zu Abbes Lebzeiten sollte das Stiftungsvermögen aus den Mitteln des Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke und - in ihrer Höhe noch nicht festgelegten - von Abbe zu bestimmenden Zuwendungen bestehen. Für den Ministerialfonds wird beginnend mit dem Jahr 1888 ein Betrag in Höhe von 20000 Mk jährlich bestimmt. Die "Letztwillige Zuwendung" wird im §7 folgendermaßen bestimmt: Behufs endgültiger und dauerhafter Erfüllung der Zwecke der Stiftung verpflichte ich mich hierdurch, sofort, nachdem dieselbe die landesherrliche Bestätigung und die Rechte der juristischen Persönlichkeit erlangt haben wird, den aus der Anlage B ersichtlichen E r b v e r t r a g mit ihr abzuschließen. Durch diesen Vertrag wird die Stiftung Universalerbin meines dereinstigen Nachlasses. Als solche tritt sie nach meinem Tode unter den in demselben angegebenen Bedingungen und Bestimmungen, insbesondere auch gegen Übernahme der darin festgelegten Leistungen an meine Familienangehörigen und andere Personen, in alle Rechte und Pflichten ein, welche nach den bestehenden Gesellschaftsverträgen in Bezug auf die beiden im Eingang der gegenwärtigen Stiftungsurkunde erwähnten gewerblichen Unternehmungen mir und meinen Erben zustehen bezüglich obliegen."
Abbe legt die Stiftung in der Stiftungsurkunde auf die Erfüllung hochgesteckter sozialer Zielstellungen fest: "Des weiteren weise ich der Stiftung die Aufgabe zu, jederzeit einzutreten für die Erfüllung der größeren sozialen Pflichten, welche ich nach meiner persönlichen Überzeugung den Gewerbsunternehmungen der Großindustrie zuweisen muß, und umsomehr den hiesigen Unternehmungen auferlegt sehe, als ich voraussetzen darf, daß diese auf lange Zeit eine wirtschaftlich besonders günstige Stellung einnehmen werden. Die Grenze dieser Pflichten ... muß seitens der Stiftung sich nicht bloß nach dem bestimmen, was die Gesetzgebung jeweils vorschreiben oder die herrschende Meinung der Unternehmerkreise für genügend befinden mag, sondern darüber hinaus nach dem Grade der eigenen Leistungsfähigkeit gegenüber der grundsätzlichen Forderung: die sozialen Schäden, welche die privatwirtschaftliche Entwicklung fabrikationsmäßiger Industriebetriebe zu begleiten pflegen, von dem Wirkungskreise der hiesigen Unternehmungen nach Möglichkeit abzuwenden." Abbe hatte mit der Errichtung der Carl-Zeiss-Stiftung und dem
Erbfolgevertrag sein großes Stiftungswerk auf den Weg gebracht,
ohne es mit dem 1889 Erreichten bereits vollendet zu sehen. 1889
gehörte ihm nur die Hälfte des Zeiss-Werkes und ein Drittel
der Firma Schott & Gen. Er war an die entsprechenden
Gesellschafterverträge gebunden und hatte Rücksicht auf die
anderen Gesellschafter zu nehmen. Allerdings endete diese
Rücksichtnahme dort, wo die weitere gedeihliche Entwicklung des
von Carl Zeiß begründeten Gesamtwerkes in Gefahr geriet.
Diese Situation ergab sich bald nach Errichtung der Stiftung. Es wurde
deutlich, daß trotz der großen Verdienste, die sich
Roderich Zeiß noch zu Lebzeiten um die Firma erworben hatte, der
nun ohne seinen Vater zu tragenden Verantwortung als Gesellschafter
nicht gerecht werden konnte. Für Abbe wurde es unerträglich,
mit dem jedes unternehmerische Risiko scheuenden Roderich Zeiß
weiter zusammenzuarbeiten, der einseitig auf ein sicheres Auskommen
orientiert und zu klaren Beschlüssen kaum fähig war. Wenn
solche Beschlüsse doch gefaßt worden waren, stieß er
diese nachträglich wieder um. Am 23. 11. 1889 war Abbe am Ende
seiner Geduld angelangt und stellte R. Zeiß vor die Wahl:
"Für jetzt bleibt also bei fortbestehendem
Gesellschaftsverhältnis nur die Alternative: entweder ich ziehe
mich von der Geschäftsführung ohne weitere Vertretung
zurück oder Sie tun dieses. - Das Erstere, was ich, wenn eine
anderweitige Vereinbarung nicht zustande kommt, als mein
vertragsmäßiges Recht in Anspruch nehmen würde, biete
ich Ihnen in erster Linie an. Wenn Sie ... sachlich den Anforderungen
sich gewachsen fühlen und bereit sind, die Arbeitslast und
persönliche Gebundenheit zu übernehmen, ... so wäre es
für mich eine W o h l t a t, mich
nunmehr von aller geschäftlichen Tätigkeit freizumachen und
meinen wissenschaftlichen Studien unbehindert obliegen zu können
... Es folgten weitere Verhandlungen, deren Resultate in den
Verträgen vom 17.-20. Juni 1891 fixiert wurden und die zur
völligen Umgestaltung der vermögensrechtlichen
Verhältnisse der Carl-Zeiss-Stiftung führten: Roderich Zeiß trat gegen eine Abfindung von 468000 Mk
alle Ansprüche aus seiner Teilhaberschaft am Zeiss-Werk und Schott
& Gen. an die Carl-Zeiss-Stiftung ab. Die Zusammenarbeit zwischen der Zeiss-Stiftung als nunmehrigem Teilhaber und Schott gestaltete sich problemlos. Otto Schott blieb Leiter des Glaswerkes und seine Anteile sollten nach seinem Tod an die Stiftung übergehen, eine ähnliche Regelung, wie sie Abbe im - nunmehr aufgehobenen - Erbeinsetzungsvertrag getroffen hatte. Und auch Schott übertrug dann bereits 1919, mehr als 15 Jahre vor seinem Tod am 17. 8. 1935, die ihm verbliebene Hälfte der Anrechte auf die Firma Schott & Gen. an die Carl-Zeiss-Stiftung. Mit der Übertragung der Geschäftsanteile an die Carl-Zeiss-Stiftung erhöhte sich das Finanzvolumen der Stiftung durch die ihr zufließenden Geschäftsgewinne ganz entscheidend (Koch, S. 288):
Insgesamt hatte die Stiftung in diesem Zeitraum 34 Millionen Mark für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung. Davon wurden 19 Millionen für die Universität und 15 Millionen für gemeinnützige Zwecke verwendet. Mit dem bei Abfassen der Stiftungsurkunde noch nicht absehbaren schnellen und umfassenden Übertragung der Geschäftsanteile am Zeiss-Werk und an der Firma Schott und Genossen an die Carl-Zeiss-Stiftung hatten sich die Potenzen und die Verantwortung der Stiftung gewaltig erhöht. Durch die Stiftungsurkunde wurden die nun anstehenden Aufgaben nur in den Grundsätzen erfaßt. Auch die Verwaltungsstrukturen der Stiftung waren der neuen Situation nur unvollkommen angepaßt. Ernst Abbe arbeitete deshalb mit Unterstützung seiner bewährten Helfer intensiv daran, der Stiftung ein Statut zu geben, das es erlaubte, ihre Potenzen effektiv im Sinne der schon in der Stiftungsurkunde festgeschriebenen grundsätzlichen Zielstellungen zu entwickeln. Für Ernst Abbe begann die geistige Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe unmittelbar mit dem Prozeß der Übertragung der Vermögensanteile an die Stiftung, aber erst fünf Jahre später war diese Arbeit so weit gediehen, daß Abbe am 28. Mai 1896 den Entwurf zu einem "Statut der Carl-Zeiss-Stiftung" übermitteln konnte, den er für unterzeichnungswürdig hielt. Vor der Unterzeichnung waren dann aber doch noch Widerstände aus Weimar zu überwinden, die sich besonders gegen soziale Festlegungen im Abbeschen Entwurf richteten. So wurde von Abbe verlangt, die Festlegung zu streichen, nach der das Höchstgehalt der leitenden Angestellten und der Mitglieder der Geschäftsleitung nicht das Zehnfache des durchschnittlichen Jahresverdienstes der Stammarbeiterschaft übersteigen dürfe (§94). Auch die für die Arbeiter vorgesehene Gewinnbeteiligung wurde vom Staatsministerium, Departement des Cultus, kritisiert. In beiden Fällen wich Abbe aber von seinem Entwurf nicht ab und setzte diese - für seine sozialpolitischen Vorstellungen ganz wesentlichen - Bestimmungen durch, so daß ihm am 30. Juli die Mitteilung zuging: "Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben auf ehrerbietigst erstatteten Antrag in der heutigen Sitzung der Großherzoglichen Gesamtministeriums dem in der Anlage A ersichtlichen Statut der Carl-Zeiss-Stiftung in Jena Höchsteigene Genehmigung zu erteilen geruht." (Schomerus, 225) Mit dem neuen Statut wurden weitere wichtige soziale Sicherungen für die Belegschaft der Stiftungsbetriebe verankert. Es wurde ein großzügiges Pensionsrecht mit Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenpensionen in Kraft gesetzt. Abgangsentschädigungen für solche Mitarbeiter wurden festgelegt, die betriebsbedingt den Betrieb verlassen mußten. Fester bezahlter Urlaub für 6 Tage und unbezahlter Urlaub für 6 Tage stand jedem Mitarbeiter zu. Es wurde Urlaub für die Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit im Reichs-, Staats- und Kommunaldienst unter Aufrechterhaltung der Bezüge gewährt. Das neue Vergütungsprinzip, bestehend aus festen Bezügen und Gewinnbeteiligungen, wurde eingeführt. Auf Basis des neuen Statuts wurde 1900 der Übergang vom Neunstundenarbeitstag zum Achtstundentag vollzogen. Die Bestätigungsurkunde für das Statut der Carl-Zeiss-Stiftung wurde schließlich am 16. August 1896 ausgestellt. Ernst Abbe hatte damit nicht nur das gewaltige Werk vollbracht, die Stiftung mit mächtigen Vermögenswerten auszustatten, sondern hatte nun mit dem Statut auch die verbindliche Festschreibung der von ihm intendierten Stiftungsziele erreicht. Damit hatte er sein Stiftungswerk unmittelbar vor dem 50jährigen Bestehen der Optischen Werkstätte vollendet. Eine in Sonderheit für die Universität Jena wichtige Erweiterung erfuhr das Stiftungsstatut von 1896 durch das Ergänzungsstatut zum Statut der Carl-Zeiss-Stiftung vom 24. 2. 1900, das den im §105 Absatz 3 eingeführten Universitätsfonds der Carl-Zeiss-Stiftung behandelt. Durch diesen Universitätsfonds wurden der Universität die ihr durch die Stiftung zugedachten Mittel durch regelmäßige jährliche Überweisungen und durch außerordentliche Zuschüsse bereitgestellt. Mit der Überweisung in diesen Fonds gingen diese Mittel in den Besitz der Universität über, waren jedoch weiter separat von den etatmäßigen Mitteln der Universität - getrennt in Verfügungsfonds und Rücklagefonds - zu verwalten. Letzterer diente dazu, wiederkehrende Leistungen, z.B. Personalkosten, auch für den Fall zu sichern, daß die aktuellen Leistungen der Stiftung für den Universitätsfonds nicht die benötigte Höhe erreichen sollten. Die regelmäßigen Zuweisungen zum Universitätsfonds ergaben sich bei Errichtung der Stiftung aus den für den Ministerialfonds vorgesehenen 20000 Mk und wurden über zuerst 30000 Mk ab 1. 10. 1895 auf 40000 Mk und ab 1. 10. 1899 auf 80000 Mk erhöht. Die außerordentlichen Zuweisungen waren dagegen, falls nicht direkt für den Reservefonds bestimmt, für vorübergehende und einmalige Aufwendungen größerer Art bestimmt. Nach Abbes Auffassung sollte sich die Stiftung bei der Übernahme wiederkehrender Leistungen wegen der damit zu verbindenden Rücklagebildung zurückhalten, um mehr Mittel für aktuelle und unmittelbar wirksame Maßnahme zur Verfügung zu haben. So waren auch bestimmte Stiftungsprofessuren, wie im Falle Gottlob Freges, personengebunden und sollten nicht wieder besetzt werden, wenn der Inhaber ausschied. Eine Erhöhung des Rücklagefonds wurde aber 1902 trotzdem nötig, als nämlich die Besoldung der Universitätslehrer im Zusammenhang mit der Beseitigung des Steuerprivilegs neu geregelt wurde. Bis dahin erhielten die Jenaer Professoren im Vergleich zu Professoren anderer Universitäten Deutschlands bedeutend niedrigere Gehälter, hatten aber zum Ausgleich das Steuerprivileg, vollständig von der Staatssteuer und zu zwei Dritteln von der Gemeinde- und Kirchensteuer befreit zu sein, eine Regelung die auch Abbe ablehnte, weil davon vor allem Vermögende in einer Weise profitierten, die nicht direkt ihrer Einstufung an der Universität entsprach. Wegen der enorm angewachsenen Mittel der Stiftung konnte Abbe aber trotzdem den Anteil der für aktuelle Projekte aufgewandten Mittel gewaltig steigern, wobei er sich auch von der in der Stiftungsurkunde 1889 aufgestellten Maxime leiten ließ, es dürfe niemals übermäßige Vorsorge für die Zukunft der jeweils lebenden Generation das natürliche Anrecht rauben, den größeren Teil dessen zu genießen, was die lebende Generation erwirbt.
Auch nach dem Tode Ernst Abbes am 14. Januar 1905 hat die Stiftung in diesem Sinne weitergewirkt und der Universität bis Ende des 1. Weltkrieges, noch während des Wirkens Gottlob Freges in Jena, durch Neubauten, Neugründungen, Ankäufe usw. ein völlig neues Gesicht gegeben. In Anlehnung an eine vom langjährigen Referenten für die Carl-Zeiss-Stiftung im Weimarischen Kultusministerium, Ministerialdirektor Wuttig, abgefaßte Aufstellung gibt Schomerus folgende Übersicht über die von der Stiftung in diesen Jahren für Universität erbrachten Leistungen: "Es wurden im Laufe der Jahre aus Stiftungsmitteln errichtet: Die Anstalt für theoretische Physik und die Anstalt für technische Chemie, ein Neubau für das Physikalische Institut und das Hygienische Institut. Es folgten die Neubauten oder umfassende Erweiterungsbauten für das Pathologisch-Anatomische Institut, das Botanische, Zoologische, Anatomische, Pharmakologische und das Chemische Institut. Dazu trat die unentgeltliche Lieferung wissenschaftlicher, namentlich optischer Ausrüstungsstücke an die Universitätsanstalten und Kliniken aller Art. Mit erheblichen jährlichen Zuschüssen wurden die mathematischen Lehrfächer bedacht; eine wesentliche Bereicherung erfuhr die juristische Fakultät durch die Gründung eines Instituts für Wirtschaftsrecht, das Gebiet der Volkswirtschaftslehre durch den Ankauf der Schmollerschen Bibliothek und durch Beihilfen für die Errichtung neuer Lehrstühle. Ein Institut für experimentelle Biologie wurde ins Leben gerufen, und in den ersten Kriegsjahren entstand das Kinderkrankenhaus der Carl-Zeiss-Stiftung, das zugleich als Kinderklinik der Universität diente. 1908 beim 350-jährigen Jubiläum der Universität wurde das stattliche und schöne neue Universitätsgebäude fertiggestellt, für das die Stiftung den Hauptteil der Kosten bereitstellte, aber auch Dr. Otto Schott erheblich beisteuerte. Beträchtliche Zuwendungen erhielt die Universitäts-Bibliothek; für sie wurde ein umfangreicher Erweiterungsbau hergestellt. Hierher gehört auch die Fürsorge für Leibesübungen der akademischen Jugend durch die Schaffung neuzeitlicher Spiel- und Sportplätze." (Schomerus, 244) Durch das Ergänzungsstatut zum Statut der Carl-Zeiss-Stiftung wurde es möglich, neben der Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer auch weitere Lehrfächer einzubeziehen und solche Zwecke zu verfolgen, deren Verwirklichung im Interesse der gesamten Universität oder der Gesamtheit der Universitätsangehörigen lag. Die obige Aufstellung zeigt, daß von dieser Möglichkeit breiter Gebrauch gemacht wurde, so daß nicht nur die mathematisch-naturwissenschaftlichen Gebiete sich aus dem beengten und wenig attraktivem Zustand, in dem sie sich vor der Förderung durch dem Ministerialfonds und die Carl-Zeiss-Stiftung befanden, zu modernen konkurrenzfähigen Institutionen entwickeln konnten, sondern die Universität als Ganzes diese Entwicklung ebenfalls vollzog. FN1
Rosenthal, Eduard: Ernst Abbe und seine Auffassung von Staat und Recht.
Rede bei der Gedächtnisfeier am 6. Februar 1910, in: Joachim
Wittig (Hrsg.): Ernst Abbe. Sein Nachwirken an der Jenaer Universität. Jena 1989, S. 29. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Ludwig Gottlob Frege wurde am 8. November 1848 in Wismar geboren. Gottlob Freges Vater, Karl Alexander Frege, war Direktor der höheren Töchterschule Wismar. Nach dem frühem Tod von Freges Vater im Jahre 1866 führte Freges Mutter, Auguste Wilhelmine Sophia Frege, geb. Bialloblotzky, die Schule weiter. Bereits in seinem Elternhaus wurde Gottlob Frege mit Ideen bekannt, die ihn auf das spätere Hauptfeld seines Wirkens führten. Sein Vater war neben seiner Tätigkeit als Lehrer auch als Autor eines Lehrbuches Hülfsbuch zum Unterrichte in der deutschen Sprache für Kinder von 9 bis 13 Jahren hervorgetreten, das 1862 bereits in 3. Auflage erschienen war und dessen erster Teil sich gerade mit der logischen Strukturierung der Sprachen beschäftigte.FN1 In Wismar ergab sich durch Freges Mathematiklehrer Leo Sachse die erste personelle Verbindung Gottlob Freges zu Jena. Von Leo Sachse könnte Frege die Anregung erhalten haben, ein Studium der Mathematik in Jena zu beginnen.FN2 Schließlich war Sachse, heute in Jena als Heimatdichter bekannt und durch einen Straßennamen geehrt, selbst Student in Jena gewesen und hatte außerdem eifrig die Veranstaltungen der von Hermann Schäffer geleiteten Mathematischen Gesellschaft in Jena besucht. Gottlob Frege schloß Ostern 1869 nach fünfzehnjärigem Besuch das Gymnasium in Wismar mit der Reifeprüfung ab und begann im gleichen Jahr das Studium in Jena. In den vier Semestern seines Jenenser Studiums hörte er 20 Vorlesungen, vor allem zu Mathematik und Physik. Seine wichtigsten Universitätslehrer in Jena waren Ernst Abbe (Theorie der Gravitation, Galvanismus und Elektrodynamik, Theorie der Funktionen komplexer Variablen, Physikalisches Praktikum, Ausgewählte Kapitel der Mechanik, Mechanik fester Körper), Karl Snell (Anwendungen des Infinitesimalkalküls auf die Geometrie, Analytische Geometrie des Raumes, Analytische Mechanik, Optik, Fundamentallehren der mechanischen Physik), Hermann Schäffer (Analytische Geometrie, Experimentalphysik, Algebraische Analysis, Über Telegraphen und andere durch Elektrizität bewegte Maschinen) und der einflußreiche Philosoph Kuno Fischer (Geschichte der Kantischen oder kritischen Philosophie).
Da Freges Studiengang auf die Oberlehrerlaufbahn ausgerichtet war, Jena aber erst ab 1874 über eine wissenschaftliche Prüfungskommission verfügte, war er schon aus diesem Grunde gezwungen, den Studienort zu wechseln. Dem Vorbild seiner verehrten Lehrer Karl Snell und Ernst Abbe folgend, ging Frege deshalb 1871 zur Fortsetzung seines Studiums nach Göttingen. Die dortige Universität verfügte nicht nur über die benötigte Kommission, sondern war vor allem auf dem Gebiet der Mathematik eine der führenden Universitäten Deutschlands, mit der sich Jena trotz des hervorragenden Mathematikers Ernst Abbe nicht messen konnte. In Göttingen hörte Frege u.a. bei Alfred Clebsch (analytische Geometrie), Ernst Schering (Funktionentheorie), Wilhelm Weber (Physikalische Vorlesungen, Experimentalphysik), Eduard Riecke (Theorie der Elektrizität) und bei dem berühmten Philosophen Rudolf Hermann Lotze (Religionsphilosophie). Über die Rolle Lotzes (1817-1881) für Freges Begründung der modernen Logik ist viel spekuliert worden, da Lotze auch einer der bedeutendsten Logiker seiner Zeit war und wegen seiner Vielseitigkeit und Originalität sogar mit Leibniz verglichen wurde.FN3 Zwar hat Frege Auffassungen vertreten, die in ähnlicher Form auch bei Lotze zu finden sind (vor allem in seinem Antipsychologismus) und hat sich explizit Positionen auseinandergesetzt, die auf Lotze hindeuten,FN4 es gibt aber keine Hinweise darauf, daß Frege mit diesen Auffassungen bereits während seiner Studienzeit in Göttingen und direkt durch Lotze konfrontiert worden ist.
Gottlob Frege kehrte danach nach Jena zurück und habilitierte sich 1874 unter dem Dekanat von Ernst Haeckel mit der Arbeit Rechnungsmethoden, die auf einer Erweiterung des Größenbegriffs gründen. Im Anschluß daran wurde er noch 1874 Privatdozent in Jena. 1879 erschien in Halle/Saale das erste Hauptwerk Freges, die Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens.FN5 Mit diesem Buch hat Frege die erste Darstellung der modernen Logik geliefert, die von seinen Zeitgenossen allerdings nicht adäquat gewürdigt werden konnte. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Begriffsschrift wurde Frege zum außerordentlichen Professor auf dem Gebiet der Mathematik berufen. 1884 erschien das zweite Hauptwerk Freges Die Grundlagen der Arithmetik,FN6 in dem er es unternahm, die für die Ausführung seines Programms der logischen Fundierung der Mathematik notwendige Definition der natürlichen Zahlen zu liefern. 1887 folgte die Heirat mit Magarete Lieseberg (1856-1904). Die Ehe blieb kinderlos, allerdings adoptierte Frege später Paul Otto Alfred Frege (geb. Fuchs). FN7
1893 veröffentlichte Frege den ersten Band seines Werkes Grundgesetze der Arithmetik,FN8 das den Höhepunkt der wissenschaftlichen Arbeit Freges markiert. Der zweite Band erschien dann im Jahr 1903.
Bevor Frege im Jahre 1918 emeritierte, wurde er 1917 vorübergehend von seinen akademischen Pflichten beurlaubt. Nach seiner Emeritierung siedelte Gottlob Frege nach Bad Kleinen bei Wismar über. Obwohl Frege so viele Jahre in Jena verbracht hat, wo er trotz seines ausgesprochen zurückhaltenden und grüblerischen Wesens zumindest bis zur Jahrhundertwende vielfältige gesellschaftliche Kontakte wahrnahm, wobei die wichtigsten sicher durch seine Zugehörigkeit zum engeren Kreis um Ernst Abbe zustande kamen, blieb Frege seiner mecklenburgischen Heimat treu. Während seines gesamten Lebens rückte er nicht davon ab, sich als Mecklenburger zu verstehen. Bis an sein Lebensende blieb für ihn bestehen, was er 1869 in seine Jenaer Immatrikulationspapiere eingetragen hatte: "Heimatland: Mecklenburg". Die Verbindung zu Mecklenburg hielt er nicht nur emotional aufrecht, sondern auch physisch: viele Jahre ließ er es sich in den Sommerferien nicht nehmen, zu Fuß die 400 km von Jena nach Wismar zurückzulegen. So kann es auch nicht verwundern, daß er sofort nach seiner Emeritierung nach Mecklenburg zurückkehrte und sich in Bad Kleinen, nur wenige Fußstunden von Wismar entfernt, niederließ und sogar daran ging, sich in einem kleinen Ort in der Nähe von Rostock ein neues Heim zu schaffen. Mitten in den Vorbereitungen zum Umzug in dieses Haus ist Gottlob Frege am 26. Juli 1925 in Bad Kleinen an einem Magenleiden verstorben. In seiner Heimatstadt Wismar wurde Gottlob Frege auf dem Stadtfriedhof beigesetzt, wo sich auch heute noch sein Grab befindet.FN10 In seinem persönlichen und wissenschaftlichen Leben ist Gottlob Frege in Jena von vielen herausragenden Persönlichkeiten beeinflußt worden. FN11 Aber sicher war es Ernst Abbe, von dem Frege in seinen wissenschaftlichen Grundsätzen am stärksten geprägt wurde. Während der langen Jahre in Jena blieben Frege und Abbe auch menschlich eng verbunden. Nicht zuletzt erfuhr Frege durch Abbe und das Abbesche Stiftungswerk auch sozial die bei weitem wichtigste Unterstützung in Jena. Wie die nur ein Jahr vor dem Tode Freges am 10. 3. 1924 entstandenen Tagebuchnotizen zeigen, war Freges Hochachtung für Abbe bis ins hohe Alter hinein ungebrochen: Professor Abbe in Jena ist einer der edelsten Menschen gewesen, die mir auf meinem Lebenswege begegnet sind. Er war, als ich in Jena studierte, zuerst mein hochverehrter Lehrer, besonders in den Fächern der mathematischen Physik. Dank seiner Vorlesungen ist mir die Einsicht in das Wesen dieses Wissenszweiges aufgegangen. Wie wenige Menschen haben eine Ahnung davon! Wie viele entbehren die strenge Zucht des Denkens, die in der Beschäftigung mit diesen Gegenständen liegt. Abbes Wiege hatte in einem Arbeiterhause gestanden. Der Adel seiner Gesinnung zeigte sich auch darin, daß er diesen Ursprung nie verleugnete. daraus erklärt sich auch sein soziales Denken und Handeln. Sein Eintritt in die optische Werkstätte von Zeiss hatte zur Folge, daß er die mathematische Theorie der optischen Werkzeuge, insbesondere des Mikroskops weiter ausbildete, immer in engem Anschluß an die Bedürfnisse und Ergebnisse seiner Aufgaben. Dadurch brachte er die optische Werkstätte von Zeiss zu hoher Blüte und wurde selbst ihr oberster Leiter. Er hatte nun endlich die Möglichkeit, die Pläne zu Gunsten seiner Arbeiter, deren Keime von seiner Wiege her in ihm lagen und die er dann während seines Wirkens im Zeisswerke ausgebildet hatte, zu verwirklichen. Er verwandelte das Zeisswerk zu Gunsten der darin beschäftigten Arbeiter in eine Zeissstiftung. Das Stiftungsvermögen hatte er selbst erarbeitet. In Wirklichkeit war es eine großartige Schenkung an die Arbeiter, nach Abbes Meinung aber hatten es die Arbeiter mit erarbeitet und gehörte es also ihnen von Rechts wegen. So glaube ich ihn recht verstanden zu haben. Es war ein aus edelster und echt christlicher Gesinnung hervorgegangener Versuch, die Arbeiter in ihrer wirtschaftlichen Lage und damit überhaupt zu heben.FN12 Ernst Abbe hat Frege auf allen Etappen seiner akademischen Laufbahn - für Frege vielfach im verborgenen - tätige Unterstützung gewährt. Es ist sicher nicht übertrieben, wenn man annimmt, Freges Werk hätte ohne Abbe nicht in Jena entstehen können.
Ernst Abbe Als Student war Frege einer der wenigen, die sich durch die Präzision und Tiefe der Abbeschen Vorlesungen angezogen fühlten und die durch Abbe gestellten hohen Anforderungen erfüllten. Es verwundert nicht, daß zu einer Zeit, als Abbe noch nicht über die später gewonnene Berühmtheit und gesellschaftliche Wertschätzung verfügte, seine Vorlesungen nur wenige Zuhörer fanden. Um die Jahre 1863/1864 waren es meist nur zwei oder drei Hörer. Zu Freges Studentenzeiten in Jena werden wohl mitunter in den Anfangsvorlesungen auch zehn bis zwölf Hörer anwesend gewesen sein, von denen aber auch noch einige im Vorlesungsfortgang wegblieben. Zum "harten Kern" aber gehörte Frege, wie Auerbach in einer Anekdote erzählt: "Als sich einmal zu einer Vorlesung nur zwei Hörer einfanden, der Mathematiker Frege und der Chemiker Michaelis ..., pflegte Abbe beim Betreten des Hörsaales zu fragen: 'Nun meine Herren, vollzählig versammelt?'"FN13 Frege hat sich in Abbes Lehrveranstaltungen und auch in den Sitzungen der von Hermann Schäffer geleiteten Mathematischen Gesellschaft, deren aktives Mitglied und Förderer auch Abbe war, sicher nicht nur durch bloße Anwesenheit hervorgetan. Das geht auch aus der 1874 abgegebenen Stellungnahme der Fakultät zu Freges Habilitationsgesuch hervor: "Herr Dr. Frege ist außerdem den Vertretern der Mathematik an unserer Universität schon von seiner Studienzeit her auf das Vortheilhafteste bekannt." FN14 Auf Abbe selbst trifft wohl auch das zu, was er später Frege attestierte: Seiner ganzen Art nach wenig dazu angetan, dem Durchschnittsstudenten besonderen Beifall abzugewinnen, hat er eine ersprießliche und jetzt sehr wertvolle Lehrwirksamkeit dadurch erlangt, daß der bessere Teil unter unseren Studierenden des mathematischen Faches allmählich mehr und mehr gewahr geworden ist, was seine Vorträge solchen zu bieten vermögen, denen Vorlesungshören etwas mehr als eine Tätigkeit der Ohren bedeutet. In der Tat ist Dr. Frege vermöge der großen Klarheit und Präcision seiner Darstellung und vermöge der Bedachtsamkeit seines Vortrags vorzüglich geeignet, strebsame Zuhörer in die schwierigsten Materien des mathematischen Studiums einzuführen: Ich selbst habe wiederholt Gelegenheit gehabt, Vorlesungen von ihm anzuhören, welche mir in Hinsicht auf die wesentlichen Punkte als vollkommen mustergültig erschienen sind.FN15 Von Abbe ist mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Anregung für Frege gekommen, sein Studium nach vier Semestern 1871 bis 1873 in Göttingen fortzusetzen. Göttingen war zu Abbes und Freges Zeiten eines der wichtigsten Zentren der Mathematik. Ein mit der Promotion erfolgreich abgeschlossenes Studium in Göttingen lieferte hervorragende Voraussetzungen für die Fortsetzung der akademischen Arbeit in Jena. In ähnlicher Weise war bereits der Studienweg Abbes verlaufen, der 1857 bis 1859 in Jena studiert hatte und dann sein Studium nach zwei weiteren Jahren in Göttingen mit der Promotion abschloß, allerdings vor seiner Rückkehr nach Jena und der Habilitation ein Zwischenjahr als Dozent am Physikalischen Verein Frankfurt verbrachte. Wie bei Abbe war auch im Habilitationsverfahren Freges Karl Snell als Gutachter vorgesehen. Da er schwer erkrankt war, regte Snell an, Abbe mit der Begutachtung der Fregeschen Habilitationsschrift Rechnungsmethoden, die sich auf eine Erweiterung des Größenbegriffes gründen zu beauftragen, was dann auch geschah. Im Resultat wurde Frege im Frühjahr 1874 durch die philosophische Fakultät der Jenenser Universität habilitiert und als Privatdozent in den Lehrkörper der Fakultät integriert. Für Abbe selbst war der Eintritt Freges in den Lehrkörper außerordentlich wichtig, denn Frege übernahm nun Vorlesungen zur Mathematik, die bisher in den Aufgabenbereich Abbes gefallen waren. Nur durch die mit Freges Engagement in der Lehre eintretende Entlastung wurde es Abbe möglich, die wachsenden administrativen und wissenschaftlichen Anforderungen seiner Tätigkeit im Rahmen der Zeiß'schen optischen Werkstätte in einer Weise zu erfüllen, die schließlich eine entscheidende Voraussetzung für den Aufstieg dieses Unternehmens zu Weltgeltung und der Verwirklichung der Abbeschen Stiftungsidee war. Abbe und Frege pflegten auch nach der Habilitation Freges weiterhin ein über das Übliche hinausgehenden gesellschaftlichen Umgang. Sie nahmen regelmäßig an den Sitzungen und anstehenden Feierlichkeiten der Schäfferschen Mathematischen Gesellschaft teil, trafen sich zu den wöchentlich stattfindenden Gesellschaftsabenden im Haus von Karl Snell. Frege war Abbe auch als Reisebegleiter lieb; als es z.B. Schäffer nicht möglich war, Abbe Pfingsten 1877 bei einem Besuch des Technikprofessors A. F. Weinhold in Chemnitz zu begleiten, trat wie selbstverständlich Frege an Schäffers Stelle. Im Jahre 1879 war es schließlich wiederum Abbe, der die Berufung Freges zum Extraordinarius, zum außerordentlichen Professor, initiierte und in einem entsprechenden Gutachten, in dem auch die oben zitierte Wertschätzung der Fregeschen Lehrarbeit enthalten ist, der Fakultät begründete. Voraussetzung für die Berufung zum Extraordinarius war die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Monographie, und Frege publizierte aus diesem Anlaß - möglicherweise unter auch von Abbe geschürtem Zeitdruck - sein erstes Hauptwerk Begriffsschrift. Eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, das zugleich die Geburtsstunde der modernen mathematischen Logik markiert. Die Aufnahme dieses Werkes, mit dem er die Fundamente der mathematischen Wissenschaft tiefer legen wollte und zu diesem Zweck die erste Darstellung der modernen Logik in einer nicht zu erwarten gewesenen Vollendung präsentierte, wurde zur ersten großen Enttäuschung im wissenschaftlichen Leben Freges. Seine Arbeit wurde kaum rezipiert und wenn sie doch wahrgenommen wurde, ergab sich als Resultat trotz der überragenden Klarheit und Präzision der Darstellung eher Mißverständnis und Irritation. Offensichtlich hatte Frege trotz seines Umganges mit Abbe auch diesen nicht genügend auf Inhalt, Form und Zweck der neuen Logik der Begriffsschrift vorbereitet. Im Gutachten zur Berufung Freges kann sich Abbe jedenfalls nicht zu einer positiven Beurteilung der Begriffsschrift durchringen, wohl aber zum Lob der wissenschaftlichen Fähigkeiten Freges: Sie [Freges Begriffsschrift] ist allerdings nur ein Nebenprodukt seiner mathematischen Forschung; diese selbst ist, wie schon die Habilitationsschrift deutlich erkennen liess, auf sehr allgemeine und weitliegende Aufgaben gerichtet, welchen gegenüber ein rascher Abschluss und frühzeitige literarische Erfolge von Niemand erwartet werden können. Ueber die erwähnte Schrift, vom Gesichtspunkte des Mathematikers ein auf das Sachliche gehendes Urtheil abzugeben, kann ich mich allerdings durchaus nicht berufen fühlen. Zu dem sehr eigenartigen Ideenkreis dieser Schrift wird wohl kaum irgend Jemand kurzer Hand Stellung nehmen können; ausserdem wird das eigentlich mathematische Gebiet, durch die Tendenz des Verfassers vielleicht sehr erheblich, durch den Gehalt der Schrift aber unmittelbar nur sehr wenig berührt. Für ein glückliches schriftstellerisches Debut kann ich deshalb diese erste Veröffentlichung meines Collegen auch keineswegs halten, ... Wie aber auch das schliessliche Urtheil über die Bedeutung und die Tragweite der von Dr. Frege entwickelten Idee sich stellen mag, soviel scheint mir in keinem Falle zweifelhaft: erstens, dass ein Mann, bei dessen mathematischen Arbeiten nebenbei eine logische Studie von so allgemeiner Tendenz abfällt, in seinem wissenschaftlichen Haushalt gewiss nicht von der Hand in den Mund lebt; zweitens, dass die Art, wie in der kleinen Schrift die abstractesten logischen und mathematischen Probleme gefasst und diskutirt werden, durchweg das Gepräge originaler Forschung trägt und eine nicht gewöhnliche geistige Kraft verräth. Diesen Eigenschaften werden, unter den Mathematikern, auch Solche den schuldigen Respekt nicht versagen, die im Uebrigen an so subtilen Untersuchungen über den formalen Zusammenhang der Erkenntniss wenig Geschmack finden möchten.FN16 Frege wurde auf Grund des Abbeschen Gutachtens zum außerordentlichen Professor berufen, wobei der Kurator der Universität seinem Antrag an das Staatsministerium in Weimar allerdings eine Information über eine weit günstigere Einschätzung der Begriffsschrift durch Lasswitz FN17 in der Jenaer Literaturzeitung beifügte. Mit der Berufung war neben dem höheren sozialen Prestige auch eine Besoldung Freges verbunden, die aber vergleichsweise bescheiden ausfiel. Freges finanzielle Situation verbesserte sich erst 1886 durch direkte, für Frege aber unbekannt gebliebene Intervention Ernst Abbes. In diesem Jahr errichtete Abbe mit Mitteln aus dem ihm zustehenden Gewinn des Zeiss-Unternehmens den Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke, der zunächst über ein Finanzvolumen von jährlich 6000 Reichsmark verfügte und vom Großherzoglich Sächsischen Staatsministerium Weimar verwaltet wurde. Zweck des Fonds war die Unterstützung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrgebiets. In seiner Erklärung vom 13. 5. 1886 bittet sich Abbe die Berücksichtigung einiger Wünsche bezüglich der erstmaligen Verfügung über die gestiftete Summe aus. Der erste und wichtigste dieser Wünsche betrifft die Verbesserung der Besoldung Gottlob Freges: So lange etatmäßige Mittel nicht vorhanden sind, um dem Professor Frege ein angemessenes Gehalt zu gewähren, bitte ich, daß demselben aus dem genannten Fonds als Remunation so viel zugebilligt werden möge, daß seine gesammten Bezüge den Betrag von beiläufig 2000 Mk erreichen.FN18 Es folgt auf anderthalb handschriftlich eng beschriebenen Seiten die Begründung für diesen Antrag, dessen Annahme in einem Schreiben vom 30. Mai 1886 durch das Staatsministerium Weimar mitgeteilt wird. In den folgenden Jahren wurde der Universität Jena für Frege aus den Mitteln des Ministerialfonds jährlich ein Betrag von 1300 Mark für Frege zugewiesen, wodurch sich dessen Gehalt auf die von Abbe geforderten 2000 Mark jährlich erhöhte. Frege erhielt damit nahezu die Hälfte aller regelmäßig vergebenen Mittel des Ministerialfonds. Frege läßt in seiner oben zitierten Tagebuchnotiz vom 10. 3. 1924 die bedeutende Unterstützung unerwähnt, die der Universität Jena durch die von Abbe im Jahr 1889 geschaffene Carl-Zeiss-Stiftung und den bereits vorher 1886 von Abbe gestifteten Ministerialfonds für wissenschaftliche Zwecke zuteil wurde, obwohl ihm Aufwendungen der Zeiss-Stiftung für die Universität sicherlich bekannt waren. Anzunehmen ist aber, daß sich Frege der Quelle der für ihn so wichtigen und in der damaligen Zeit ungewöhnlichen finanziellen Hilfe durch den Ministerialfonds und später durch die Carl-Zeiss-Stiftung nicht bewußt war. Ganz sicher wußte er nicht, daß er diese Hilfe der direkten Intervention von Ernst Abbe verdankte, denn Abbe war streng darauf bedacht, zu seinen Lebzeiten nicht als persönlicher Stifter derartiger Hilfen bekannt zu werden. FN19 Es könnte gerade Frege gewesen sein, auf den sich Abbe in der durch Auerbach berichteten bitter-ironischen Weise bezieht: "Besonderen Spaß machte es ihm, sich Angriffe auf den Charakter seiner Bestrebungen aus dem Munde von Personen anzuhören, die aus dem Ertrage der Stiftungen Gehalt und Unterstützung erhielten; und er begnügte sich in solchen Fällen damit, sich im stillen zu denken: Na, du weißt auch nicht, daß du den Ast absägen willst, auf dem du sitzest."FN20 Ernst Abbe achtete auch in den folgenden Jahren im Zusammenhang mit der Errichtung der Carl-Zeiss-Stiftung darauf, daß die Unterstützung Freges als Stiftungsprofessur festgeschrieben wurde. Mit der dritten Professur für Mathematik ist die Umwandlung der Fregeschen außerordentlichen Professur in eine ordentliche Honorarprofessur angesprochen. Es dauerte aber noch bis 1896 ehe Frege, wieder unter Einflußnahme Abbes, endlich zum ordentlichen Honorarprofessor ernannt wurde. Vgl.: Kreiser, Lothar: Freges außerwissenschaftliche Quellen seines logischen Denkens. In: I. Max/W. Stelzner, Logik und Mathematik. Frege-Kolloquium Jena 1993. Berlin/New York, 218-225. |
Die Wissenschaft der Logik ist eine der ältesten und traditionsreichsten Wissenschaften überhaupt. Ihr Begründer ist der Philosoph Aristoteles (384-322 v.Z.). Seit Aristoteles wurde unter der Logik traditionell eine philosophische Disziplin verstanden, die sich zwar formaler Mittel bediente, aber auf die Lösung von Problemen gerichtet war, die als der Philosophie zugehörig betrachtet wurden. In einem allgemeinen Sinne wurde unter der Logik die Wissenschaft von den Prinzipien richtigen Denkens verstanden, eines Denkens, das sich folgerichtig vollzieht und vor Irrtümern, die aus der Anwendung fehlerhafter Prinzipien entstehen, möglichst gefeit ist. Besondere Aufmerksamkeit wandte die Logik im Laufe ihrer Entwicklung der Analyse wissenschaftlicher Theorien und des theoretischen wissenschaftlichen Instrumentariums zu. Zu den von der Logik behandelten Fragen gehören deshalb: Wie muß ein gültiger Schluß aufgebaut sein, was muß von einem Beweis verlangt werden, welche Anforderungen müssen brauchbare Definitionen erfüllen. Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Entwicklung der Logik war die Aufdeckung der Struktur gültiger Argumentationsprinzipien, wodurch sich ein enger Zusammenhang zwischen Logik und Rhetorik ergab. Eine weitere enge Verbindung, an der auch Aristoteles orientiert war, bestand zwischen Logik und Grammatik. Aristoteles hat auf all diesen Gebieten Ideen entwickelt, die an Tiefe, Präzision und Systematik für Jahrhunderte Maßstäbe setzten, auf die sich selbst die führenden Logiker des 19. Jahrhunderts, darunter auch Gottlob Frege, noch bezogen. Aristoteles verdanken wir das erste vollständig ausgearbeitete System eines Teilbereiches der Logik, nämlich seine Theorie der Syllogismen. Dort werden Schlüsse behandelt, in denen aus zwei Voraussetzungen (Prämissen) eine Schlußfolgerung (Konklusion) gezogen wird. Sowohl die Prämissen als auch die Konklusion sind sogenannte kategorische Urteile der Form Alle S sind P, Kein S ist P, Einige S sind P und Einige S sind keine P. Der Einfluß der aristotelischen Logik war so stark, daß noch Immanuel Kant (1724-1804) aus ihrer Dominanz den Schluß zog, die Logik insgesamt sei mit der aristotelischen Logik vollendet. Allerdings war das Kantsche Urteil auch dadurch bedingt, daß wichtige logische Entwicklungen vor Kant in Vergessenheit geraten waren, die den theoretischen Rahmen der aristotelischen Logik überschritten. So konnte er die bedeutenden Ansätze der Stoiker zur Entwicklung der Aussagenlogik, deren erstes vollständiges System später von Frege geschaffen wurde, nicht in seine Wertung der Entwicklung der Logik einschließen. Insbesondere waren die logischen Ideen von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), die auf die Anwendung mathematischer Methoden in der Logik gerichtet waren, für Kant nicht zugänglich. Eine neue Qualität der Logikentwicklung markiert das 1847 erschienene Werk von George Boole (1815-1864) The Mathematical Analysis of Logic. In diesem Werk wird die Logik mit mathematischen Mitteln aufgebaut und als Algebra der Logik dargestellt. Boole hatte erkannt, daß die Syllogistik nur einen kleinen Teilbereich logischer Schlüsse behandelt und für die Darstellung der logischen Verhältnisse in der Mathematik ungenügend ist. Mit Boole beginnt die unmittelbare Geschichte der mathematischen Logik. Er entwickelt in Form seiner Klassenalgebra eine Logik, die bedeutend leistungsfähiger ist als die aristotelische Syllogistik. In dieser Logik wird ein vollständiges System der einstelligen Prädikatenlogik geliefert. Hier sind genau die logischen Gesetze beweisbar, die sich auf die logischen Beziehungen zwischen Eigenschaften richten. Die Syllogistik selbst ist in diesem System vollständig enthalten. Wichtige Nachfolger von Boole waren Augustus De Morgan (1806-1878), Ernst Schröder (1841-1902) und Charles Sanders Peirce (1839-1914), die daran arbeiteten, das Boolesche System zu präzisieren und in Richtung auf die logische Analyse von Relationen zu erweitern. Das erste vollständige System der Aussagen- und Prädikatenlogik ohne Beschränkung auf einstellige Prädikate aber hat auf einer ganz neuen logischen Basis, seiner Begriffsschrift, Gottlob Frege aufgebaut, der damit zum Begründer der modernen Logik wurde. Frege baut die Logik als eigenständige Disziplin auf, die zwar zwischen Mathematik und Philosophie steht, weder Teil der Mathematik noch Teil der Logik ist und zu einem wichtigen Analysemittel sowohl für die Mathematik als auch für die Philosophie und andere Wissenschaften wird. |

der Schriften Freges
|